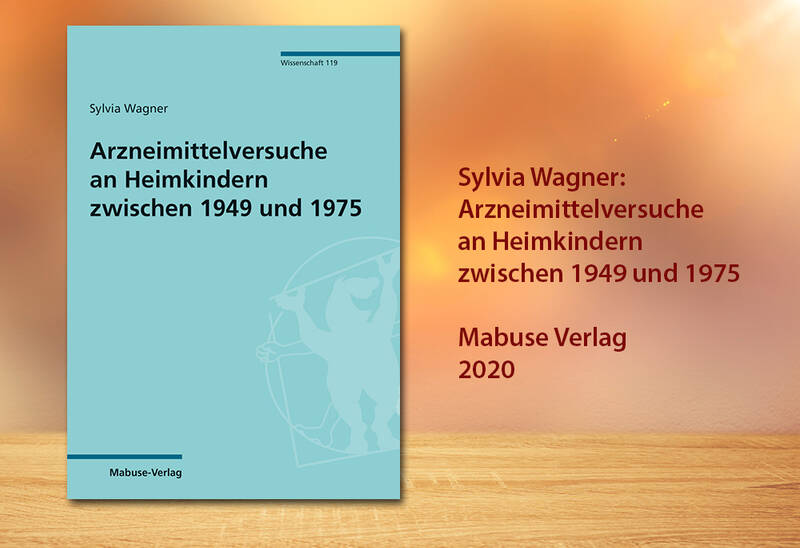Einen typischen Tagesablauf am Beispiel von einem Kinderkurheim in Bad Sassendorf, dem Tagungsort des Kongresses, stellte die Historikerin Dr.Lena Krull von der Universität Münster vor. Bad Sassendorf hat eine lange Tradition als beliebter Kurort, vor allem durch die Nutzung des Gradierwerks als Freiluftinhalation mit solehaltiger Luft.
Als auffällig konnte Krull bei ihrer Recherche feststellen, dass die Schlafzeiten einen erheblichen Raum einnahmen. Mehr als zwölf Stunden Nachtruhe plus zwei bis drei Stunden Mittagsschlaf für alle Kinder, unabhängig vom Alter, ließen kaum noch Zeit für Freizeitaktivitäten oder persönliche Zuwendung. Der Rest des Tages orientierte sich an den Mahlzeiten entlang und auch für die Körperhygiene waren nur kleine, klar definierte Zeitfenster vorgesehen, in denen es den Kindern überhaupt erlaubt war, die Toilette aufzusuchen. Ein Grund für dieses Vorgehen war eine Überforderung des Personals aufgrund von zu knappen Ressourcen, wie Krull anhand von Archivdaten nachweisen konnte.