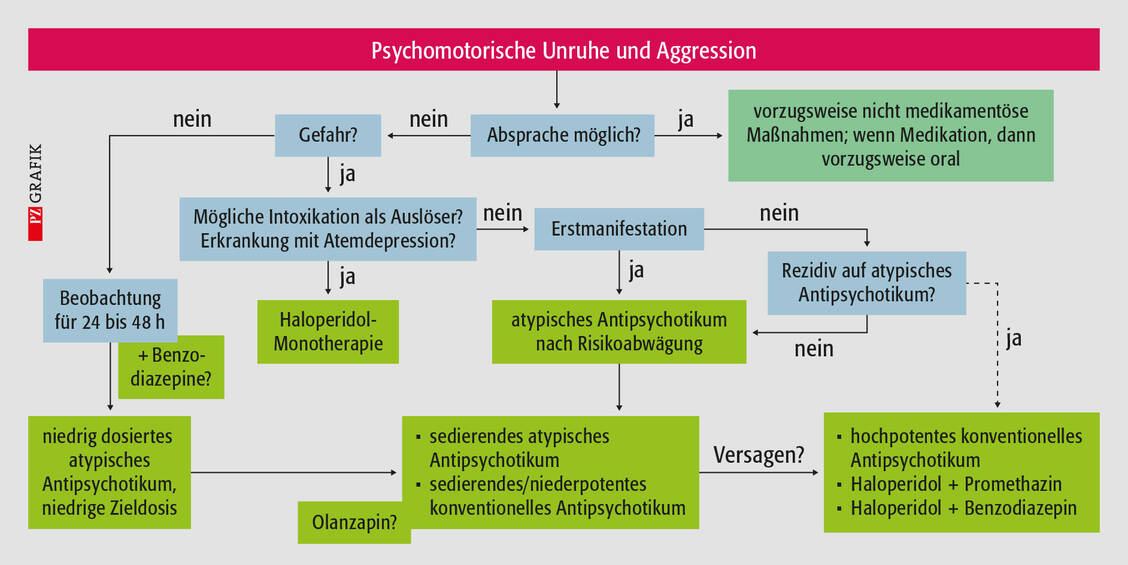Häufig beantworten wir diese Frage im soziologischen Kontext. Menschen erleben Aggression als etwas, das aus der Situation entsteht: als Reaktion auf empfundene Ungerechtigkeit, Überforderung oder Bedrohung. Aggression kann helfen, eine Herausforderung zu überstehen, sich durchzusetzen oder Schaden abzuwenden. Das Elternhaus, der persönliche Lebensweg und die Kultur formen, wie Menschen mit ihren Aggressionen umgehen. Je nach Situation können verschiedene gesellschaftliche Normen zum Tragen kommen: am Familientisch andere als auf dem Fußballfeld zum Beispiel.
Auch im medizinischen Umfeld entstehen häufig Aggressionen. Missempfinden und Krankheiten sind für die Patienten unangenehm, schmerzhaft oder bedrohlich. Die Nerven liegen blank und das komplexe Gesundheitssystem wirkt schnell ungerecht oder überfordernd. Oft sind Patienten herausgerissen aus ihrem »normalen« Umfeld und wissen nicht, wie sie sich verhalten sollen und was auf sie zukommt. Aggression als spontane Reaktion hierauf ist verständlich. Nur schwer kann man jedoch verstehen, warum Aggression immer häufiger zu Konflikt, Drohung und Gewalt wird.
Auch Heilberufler erleben Aggression und Gewalt. Körperliche Übergriffe auf medizinisches Personal haben zugenommen. Laut einer Sonderauswertung der polizeilichen Kriminalstatistik wurden 2023 in Krankenhäusern 126 Fälle von Körperverletzung und tätlichen Angriffen festgestellt. Im Vorjahr waren es noch 115.
Die Berufsgenossenschaft für Gesundheitsdienst und Wohlfahrtspflege (BGW) registriert jährlich rund 5300 gewalttätige Übergriffe auf Pflegekräfte. Auch in den Praxen nimmt das Problem zu. In einer Umfrage der Kassenärztlichen Bundesvereinigung gaben knapp 80 Prozent der niedergelassenen Versorger an, 2023 verbale Gewalt wie Beschimpfungen oder Drohungen erlebt zu haben. Laut Umfrage waren mehr als 40 Prozent der etwa 7600 Befragten in den letzten fünf Jahren schon einmal angegriffen worden.