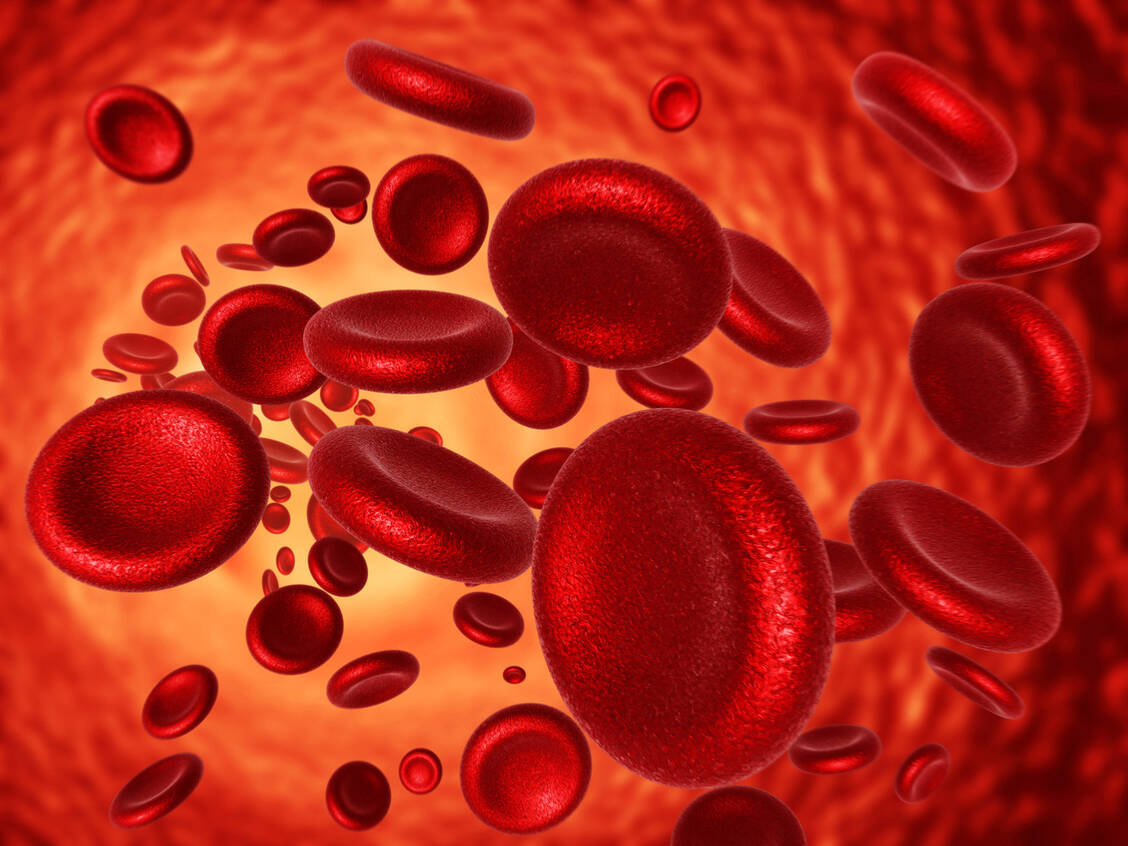Die akute hepatische Porphyrie (AHP) ist eine seltene, erbliche Stoffwechselerkrankung. Aufgrund eines genetischen Defekts mangelt es Betroffenen an einem der Enzyme, die für die Häm-Biosynthese verantwortlich sind. In der Folge akkumulieren Porphyrine, Zwischenprodukte der Häm-Synthese, was zu Attacken mit sehr schweren Bauchschmerzen, Erbrechen und epileptischen Krampfanfällen führen kann. Diese können lebensbedrohlich sein, da es während der Attacken zu Lähmungen und Atemstillstand kommen kann. Im Akutfall ist eine sofortige ärztliche Notfallbehandlung erforderlich. Zudem leiden viele Patienten zwischen den Schüben unter chronischen Symptomen wie Schmerzen. Belastend ist auch die ständige Angst, eine erneute Attacke zu erleiden.