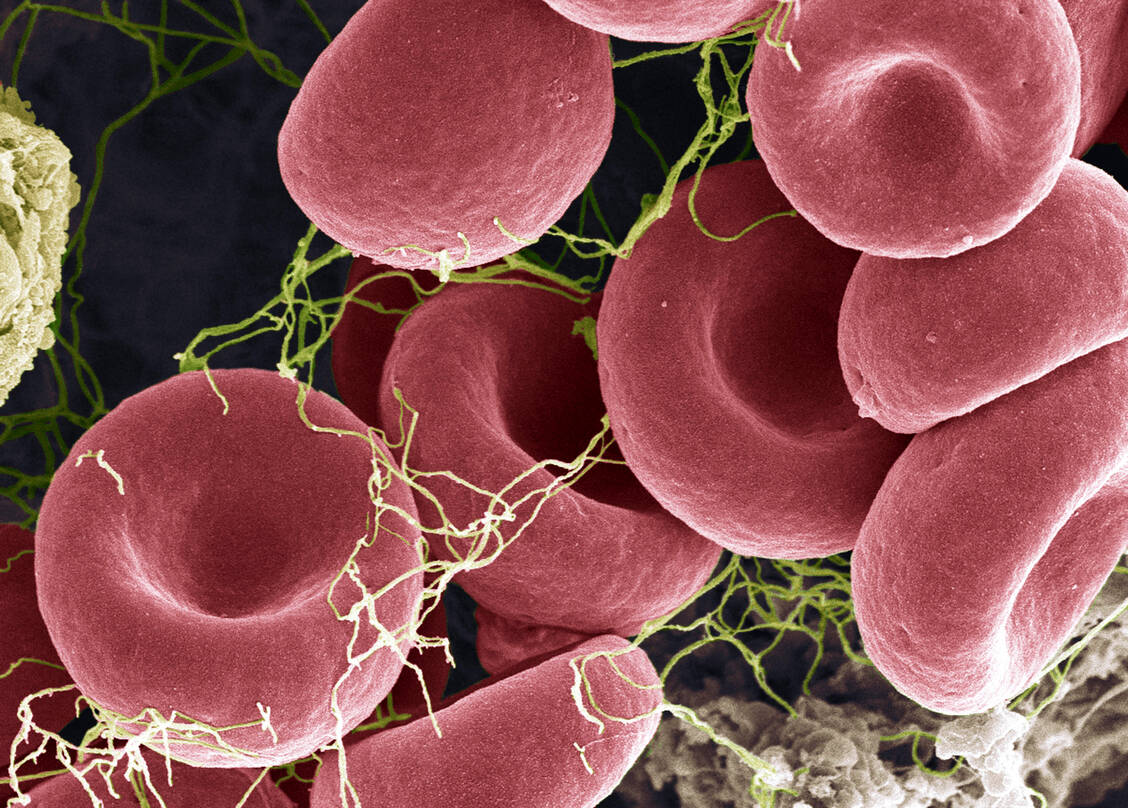Im Fachjournal »Thrombosis and Haemostasis« vertreten die Forscher die Ansicht, dass die Aktivierung des Komplementsystems über den MBL-Lektin-Signalweg zu der Koagulopathie bei Covid-19 beiträgt. »Unsere Ergebnisse sind besonders interessant, weil wir annehmen, dass MBL die Gerinnung in einer Weise anregt, die durch Blutverdünner nicht verhindert werden kann«, sagt Eriksson in einer Mitteilung der Universität Uppsala. Das könne auch erklären, warum so viele Patienten trotz der Antikoagulation, die zur Standardbehandlung gehört, Thromboembolien entwickeln. MBL scheint zusammen mit MASP-1, einem weiteren Enzym, die Blutgerinnung über mehrere Mechanismen zu erhöhen, unter anderem durch die direkte Aktivierung des Faktors XIII. Das in der Antikoagulation in der Regel verwendete niedermolekulare Heparin hemmt dagegen hauptsächlich Faktor Xa.