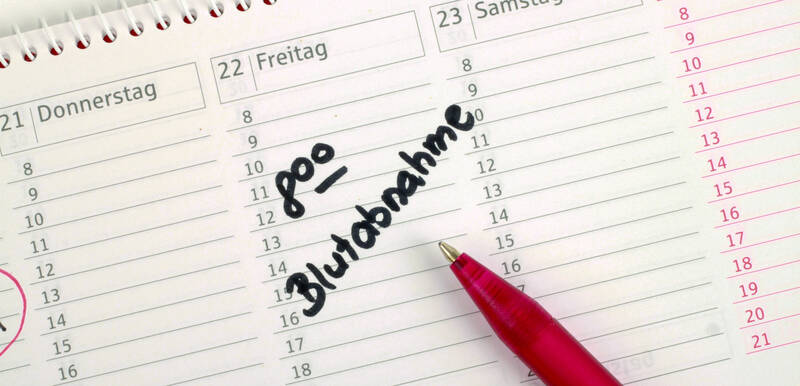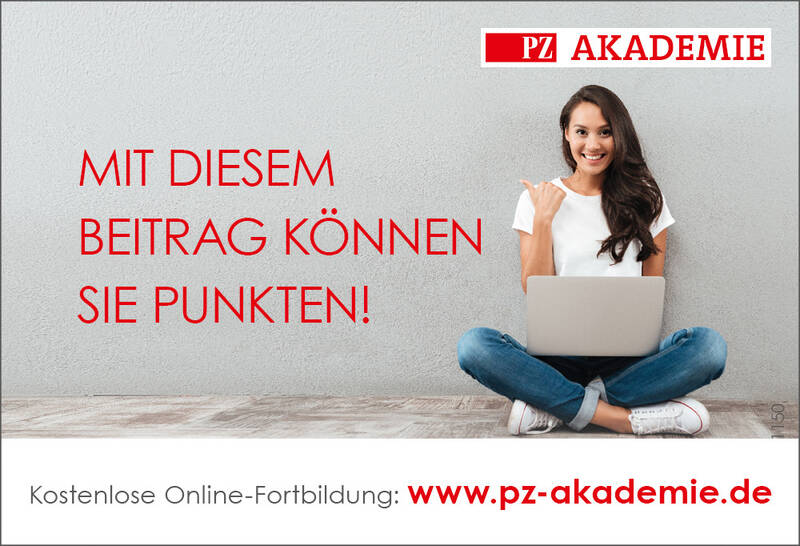|
Vitamin
|
Vorkommen
|
|
Mengenangaben in mg/100 g
|
|
|
Thiamin (B1)
|
Weizenkeime (0,9 bis 1), Sonnenblumenkerne (1,9), Haferflocken (0,5 bis 0,6), Paranüsse (1,0), Erbsen und Linsen getrocknet (0,5 bis 0,6), Naturreis (0,4 bis 0,5), Schweinefleisch (0,6 bis 1,0)
|
|
Riboflavin (B2)
|
Mandeln (0,8 bis 1,1), Champignons (0,4 bis 0,5), Spinat (0,2 bis 0,3), Brokkoli (0,2), Rinder- und Schweineleber (2,6 bis 3,0), Milch (0,18), Käse (0,4 bis 0,5), Eier (0,4), Fisch (0,3 bis 0,4)
|
|
Niacin (B3)
|
Erdnüsse (12 bis 14), Haferflocken (1 bis 2), Champignons (3 bis 4), Kartoffeln (1 bis 2), Hühner-/Putenfleisch (10 bis 14), Thunfisch gegart (10 bis 15), Lachs gegart (8 bis 10), Eier (0,1 bis 0,2)
|
|
Pantothensäure (B5)
|
Sonnenblumenkerne (6 bis 7), Champignons (2 bis 3), Vollkornprodukte (1 bis 2), Avocado (1 bis 1,5), Brokkoli und Blumenkohl (0,5 bis 0,8), Kartoffeln (0,3 bis 0,5), Rinder-/Schweineleber (6 bis 7), Eigelb (2 bis 3), Lachs und Forelle (0,6 bis 1,0), Milch 3,5 % (0,3 bis 0,5), Camembert (0,3 bis 0,4)
|
|
Pyridoxin (B6)
|
Haferflocken (0,9), Linsen und Erbsen getrocknet (0,5 bis 0,6), Sonnenblumenkerne (1,3), Wal- und Haselnüsse (0,5 bis 0,7), Bananen (0,3 bis 0,4), Avocado (0,3 bis 0,4), Hühnerfleisch (0,5 bis 0,9), Schweinefleisch (0,4 bis 0,6), Lachs gegart (0,5 bis 0,8), Thunfisch gegart (0,8 bis 1,0), Rinder-/Schweineleber (0,9 bis 1,2), Eier (0,1 bis 0,2)
|
|
Mengenangaben in µg/100 g
|
|
|
Biotin (B7)
|
Haferflocken (20 bis 25), Sojabohnen gekocht (15 bis 20), Erdnüsse (30 bis 35), Walnüsse (15 bis 20), Mandeln (15 bis 20), Spinat (5 bis 10), Brokkoli (5 bis 10), Rinderleber (100 bis 200), Eigelb (50 bis 60), Lachs gegart (5 bis 10), Milch (2 bis 5), Camembert (4 bis 6)
|
|
Folat (B9)
|
Spinat (145 bis 190), Grünkohl (140 bis 180), Rucola (100 bis 150), Brokkoli (90 bis 110), Linsen und Erbsen (130 bis 150), Avocado (60 bis 80), Wal-/Erdnüsse (100 bis 150), Kalbsleber (200 bis 300), Eier (50), Milch-/Käseprodukte (5 bis 20)
|
|
Cobalamin (B12)
|
Schweine-/Rinder-/Kalbsleber (25 bis 70), Lachs gegart (3 bis 8), Thunfisch gegart (4 bis 9), Eier (1 bis 2), Milch 3,5?% (0,4 bis 0,6), Käse (2 bis 3), nicht/in Spuren in pflanzlichen Lebensmitteln
|