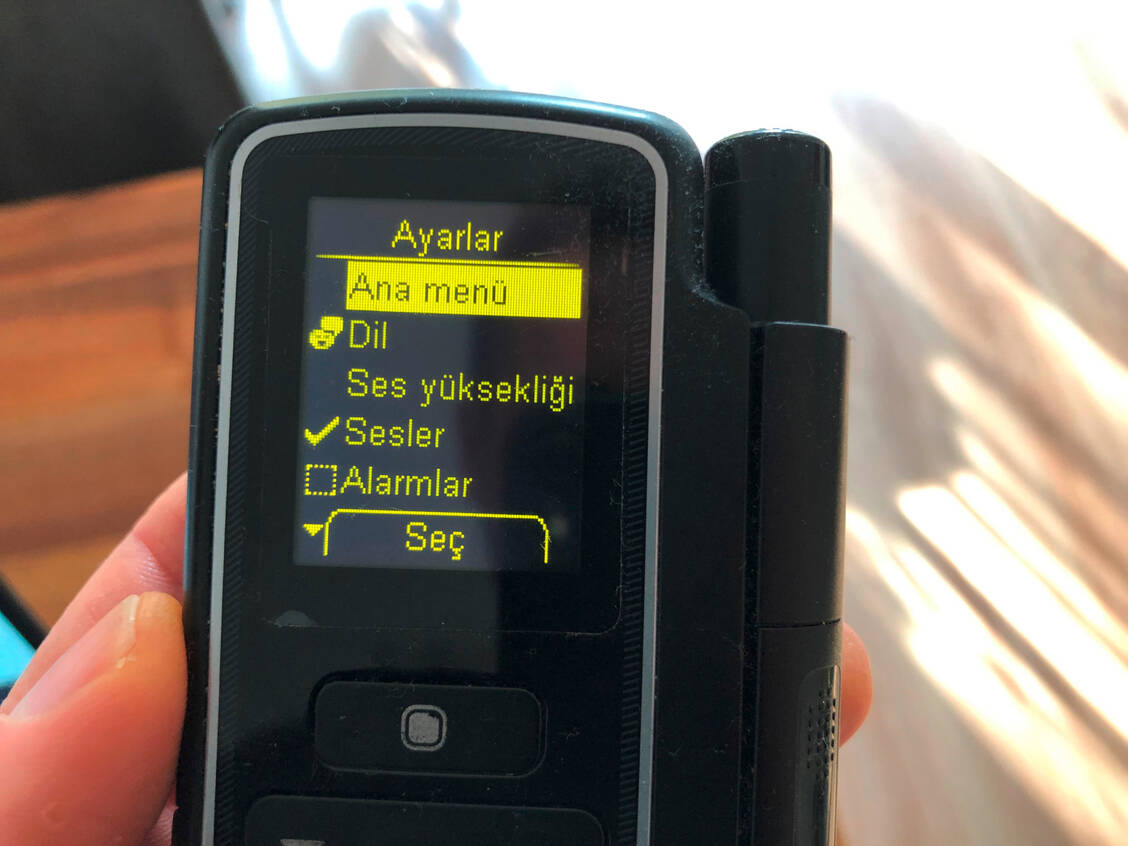Bei einer Presseveranstaltung der Deutschen Diabetes Gesellschaft (DDG) betonte Professor Dr. Werner Kern, Ärztlicher Leiter des Endokrinologikums in Ulm, wie wichtig es ist, sich interkulturelle Kompetenzen anzueignen, um Menschen mit Migrationshintergrund im Umgang mit Typ-2-Diabetes gut betreuen zu können. In einer begleitenden Pressemitteilung der DDG wird darauf verwiesen, dass Menschen mit Migrationshintergrund je nach Herkunftsregion deutlich häufiger, früher und stärker von Typ-2-Diabetes betroffen sind als die restliche Bevölkerung. Viele der Migranten hierzulande stammen aus der Türkei, Polen, Russland oder aus Nordafrika – Regionen, bei denen in den nächsten Jahren mit einer besonders hohen Zunahme der Inzidenz an Diabetes gerechnet wird, nennt die DDG ein weiteres wichtiges Argument, sich spezielle Kompetenzen für die Betreuung der Betroffenen anzueignen.