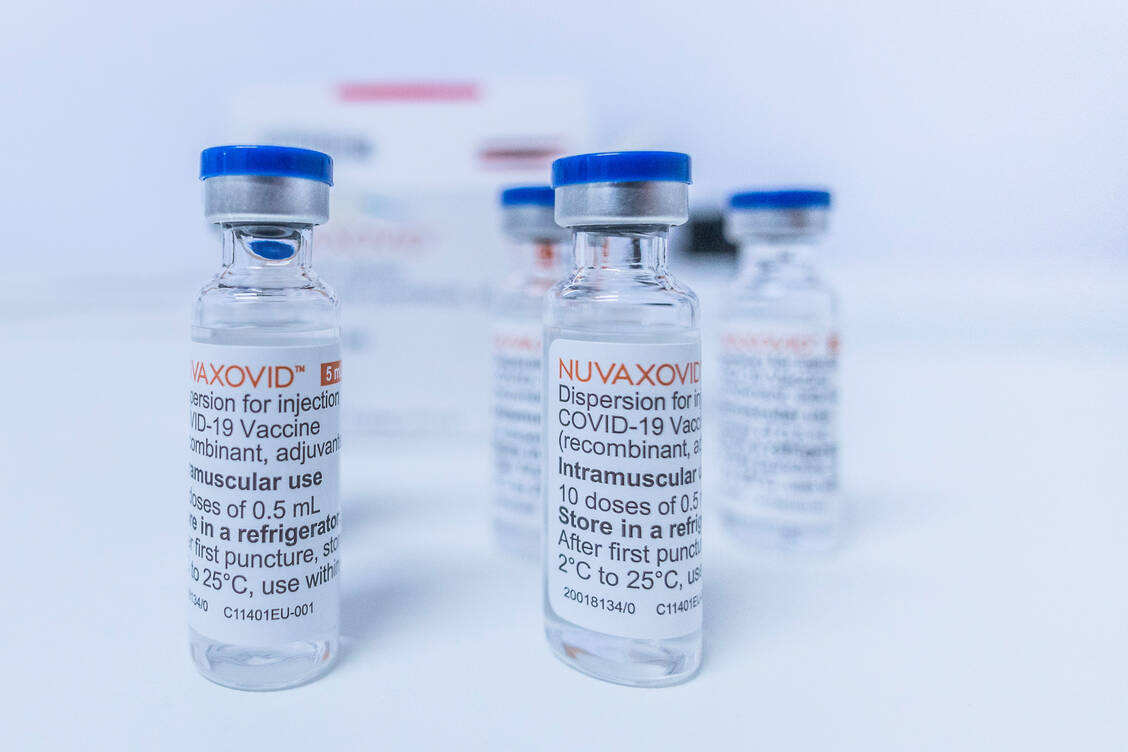Es zeigte sich, dass durch die Wahl von Matrix-M als Adjuvanz in den ersten 24 Stunden vorwiegend lokale Immunreaktionen an der Einstichstelle induziert wurden, ohne dass die Immunreaktionen in die Peripherie überschwappten. Dies schlossen die Forschenden aus der Beobachtung, dass nach der Impfung im Blut nur wenige Transkriptionsveränderungen nachweisbar waren, wobei diese hauptsächlich mit myeloischen Zellen und Typ-I-Interferon-Reaktionen in Verbindung standen. An der Injektionsstelle im Muskel und in den benachbarten Lymphknoten beobachteten die Forschenden eine starke Immunaktivierung. Dies könnte erklären, warum dieser Impfstoff von vielen geimpften Personen besser vertragen wird als die mRNA-Impfstoffe.