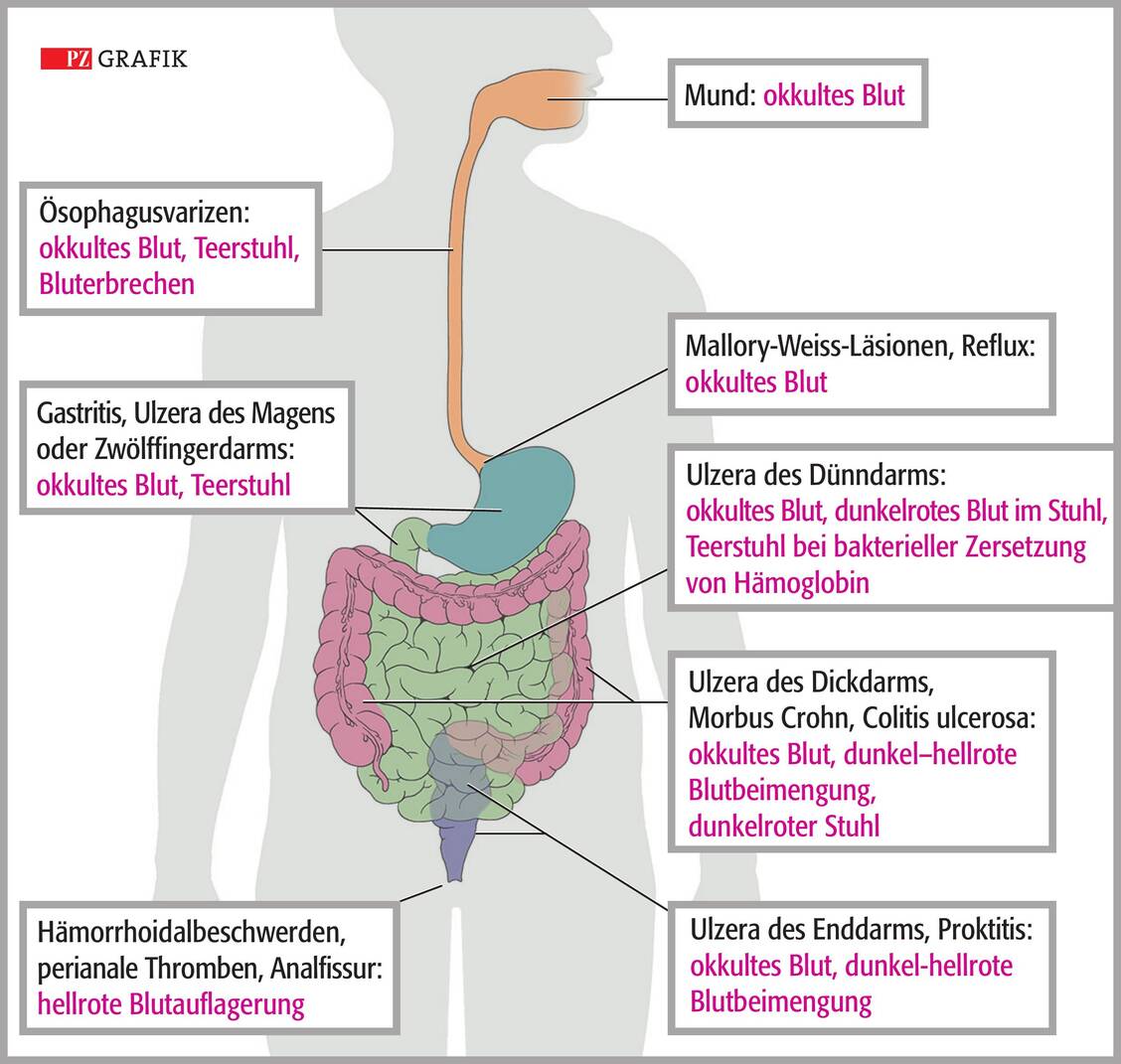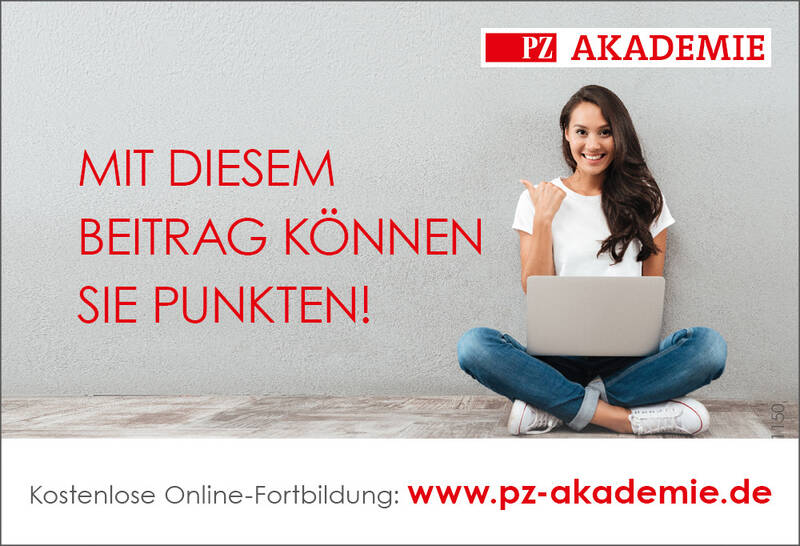Die Farbe des Stuhls wird durch verschiedene Faktoren bestimmt. Bei der Verdauung der Nahrung werden Verdauungssäfte aus Bauchspeicheldrüse und Galle benötigt. Gallenflüssigkeit besteht aus Wasser, fettverdauenden Gallensalzen und Gallenfarbstoffen. Letztere entstehen beim Abbau von roten Blutkörperchen. Dabei entsteht gelblich-rötliches Bilirubin und grünes Biliverdin. Im Darm wird grünes Biliverdin zu braunem Stercobilin metabolisiert, das dem Stuhl die charakteristische Färbung verleiht.
Je nach den gegessenen Lebensmitteln verändert sich die Stuhlfarbe für kurze Zeit in grünlich-schwarz (Spinat) oder rötlich (Rote Bete, Beeren). Sind keine Nahrungsmittel dafür verantwortlich, sollte bei rötlichem oder schwarzem Stuhl sowie bei Blutbeimengungen immer der Arzt hinzugezogen werden.
Durchfall sowie Lebensmittel wie Milch, Eier oder Stärke können den Stuhl gelblich verfärben. Entfärbt sich Kot lehmgelblich oder grau-weiß, kann eine Gallen-, Leber- oder Bauchspeicheldrüsenfunktionsstörung zugrunde liegen, die ärztlich abzuklären ist.
Ein hoher Verzehr von Chlorophyll-haltigen Lebensmitteln wie Salat verfärbt den Stuhl grünlich. Durchfall dieser Farbe kann aber auch eine bakterielle Infektion (häufig Salmonellen) anzeigen. Wird reichlich rotes Gemüse verzehrt (Kürbis, Karotte), wird auch der Stuhl deutlich orange gefärbt sein. Nahrungsmittel, die viel Lebensmittelfarbe enthalten, können ebenfalls die Farbe des Stuhls verändern.
Verschiedene Medikamente verfärben den Stuhl rötlich bis schwarz. Orlistat führt zu gelblichen Fettstühlen, Rifampicin kann den Stuhl orange verfärben. Eine Antibiotikatherapie führt mitunter zu gelber oder grünlicher Stuhlfärbung. Auf diese Veränderungen sollten die Patienten hingewiesen werden, damit sie sich keine Sorgen machen.