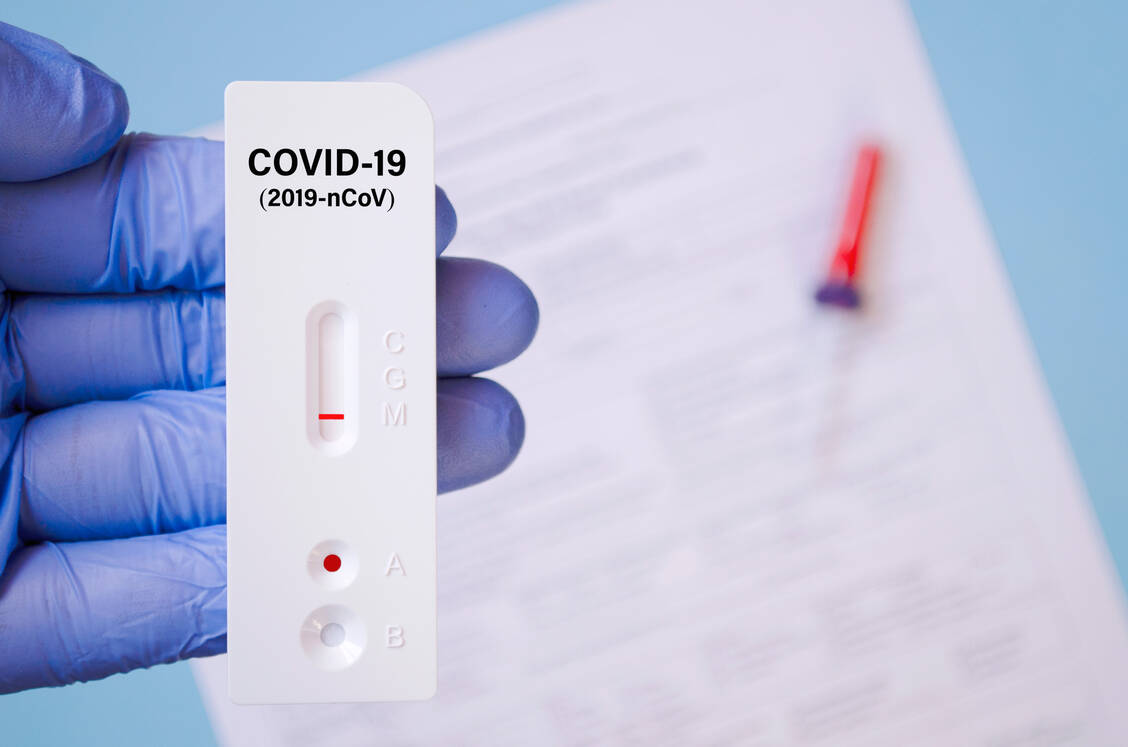Die Patienten, deren Daten in der Studie begutachtet wurden, waren entsprechend ihres ersten SARS-CoV-2-Antikörpertest als Antikörper-positiv oder Antikörper-negativ kategorisiert worden. Als primären Endpunkte ihrer Studie definierten die Wissenschaftler PCR-Testergebnisse, die bei den Patienten jeweils 0-30 Tage, 31-60 Tage, 61-90 Tage und > 90 Tage nach der Infektion ermittelt worden waren. Diese Ergebnisse erlauben Rückschlüsse auf die Persistenz der Viren nach dem initialen Infektionsereignis. Zusätzliche Messgrößen waren demografische, geografische und klinische Merkmale zum Zeitpunkt des ersten Antikörpertests, sowie Anzeichen und Symptome von Covid-19 und Komorbiditäten. Insgesamt wurden die Daten von 3.257.478 Patienten eingeschlossen, bei denen ein Antikörpertest durchgeführt worden war. Das mittlere Alter dieser Patienten betrug 48 Jahren. 56 Prozent der eingeschlossenen Patienten waren weiblich.