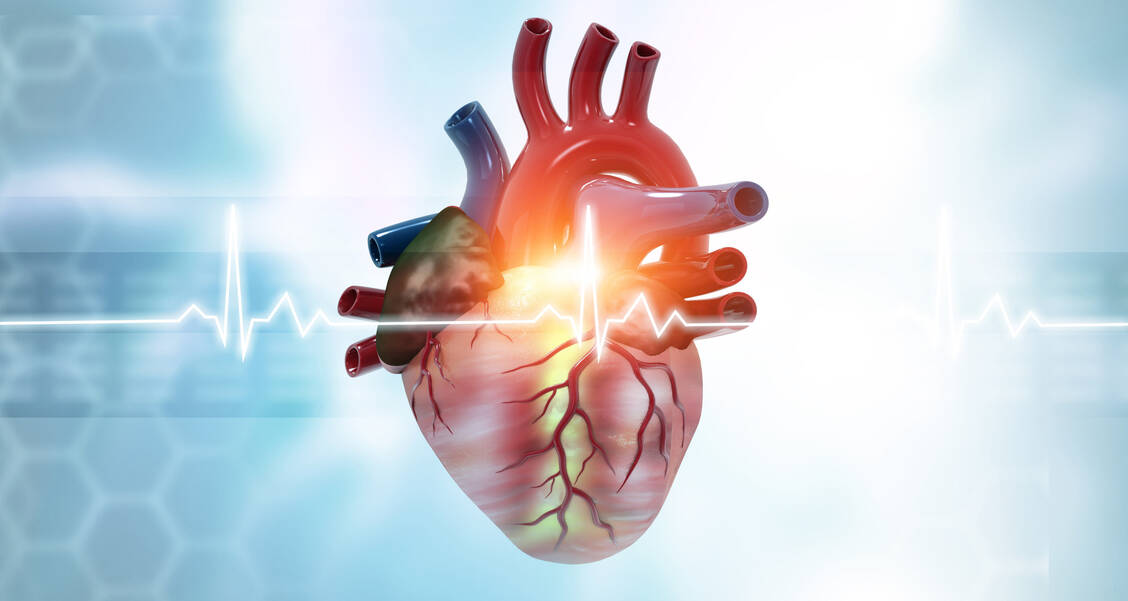Therapiebedürftige Veränderungen der Anionenkonzentrationen sind insgesamt eher selten. Sie treten auf, wenn zum Beispiel die entsprechende Kationenkonzentration verändert ist, so wie bei dem Ionenpaar Natrium und Chlorid.
Chloridionen kommen mengenmäßig vorrangig in der extrazellulären Flüssigkeit vor. Chlorid spielt eine wichtige Rolle für die Aufrechterhaltung des osmotischen Drucks und die Regulation des Flüssigkeitshaushalts. Außerdem ist es als Salzsäure wichtiger Bestandteil der Verdauungssekrete des Magens. So ist Chlorid in Form von HCl an der Verdauung von Nahrung und der Eliminierung von Krankheitserregern beteiligt. Chlorid wird fast ausschließlich in Form von Natriumchlorid zugeführt.
Hydrogencarbonat (Bicarbonat) ist ein wichtiger Baustein des Bicarbonatpuffers des Bluts. Es sorgt dafür, dass der Säure-Basen-Haushalt des Bluts im Lot ist. Niedrige Bicarbonatkonzentrationen sind nachweisbar, wenn eine metabolische Ketoazidose vorliegt, der pH-Wert des Bluts zu sauer ist, Bicarbonat zur Abpufferung benötigt wird und CO2 vermehrt über die Lunge ausgeatmet wird.
Phosphationen liegen im Wesentlichen in der Knochensubstanz und den Zähnen als Calciumverbindungen vor. Ein ernährungsbedingter Phosphormangel ist nicht bekannt, da nahezu alle Lebensmittel Phosphor enthalten. Ein kleiner Phosphatanteil wird in den Zellen zur Energiebildung und in den Puffersystemen des Bluts benötigt. Normalerweise stellt eine gesunde ausgewogene Ernährung eine ausreichende Zufuhr von Phosphaten sicher.