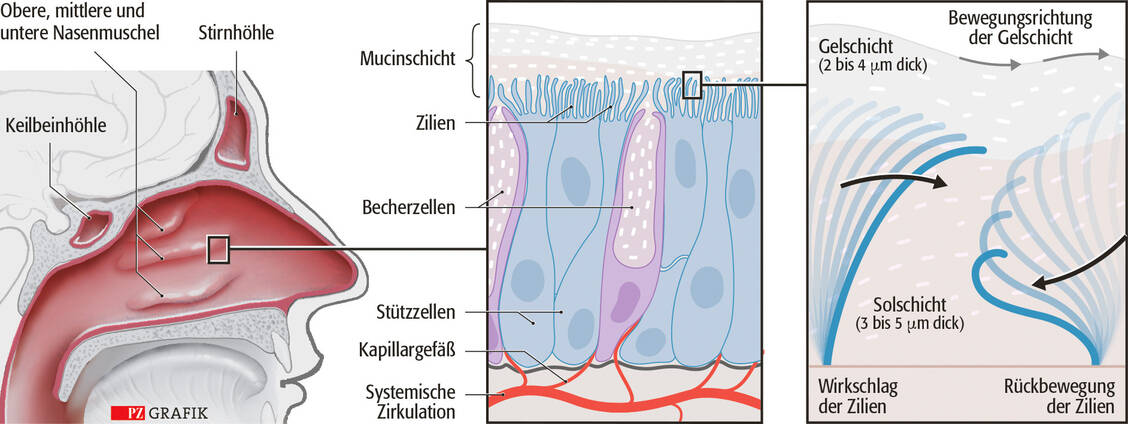Den zugrunde liegenden Ursachen gilt es, beim Hals-Nasen-Ohren-Arzt auf den Grund zu gehen. Erst dann kann eine passende Therapie eingeleitet werden. Topische Glucocorticoide kommen zum Einsatz, wenn der persistierenden Sekretion entzündliche Veränderungen zugrunde liegen. Verschiedene Eigenschaften sprechen für den Einsatz topischer Steroide wie Mometason, Fluticason, Budesonid oder Beclometason (wie Nasonex®, Flutide® Nasal, Pulmicort Topinasal®). »So ist ihre abschwellende und sekretionshemmende Wirkung auf die Nasenschleimhaut auch bei primär nicht allergischen endonasalen Schwellungszuständen beschrieben. Während es einige Tage braucht, bis antiinflammatorische Mechanismen über den Glucocorticoid-Rezeptor greifen, reduziert sich etwa die Gefäßexsudation in der entzündeten Schleimhaut bereits wenige Minuten nach Applikation«, erklärt Klimek. Und wegen ihrer Lipophilie penetrieren die Substanzen zwar rasch durch die Zellmembran. Ihre systemische Resorption sei jedoch marginal.