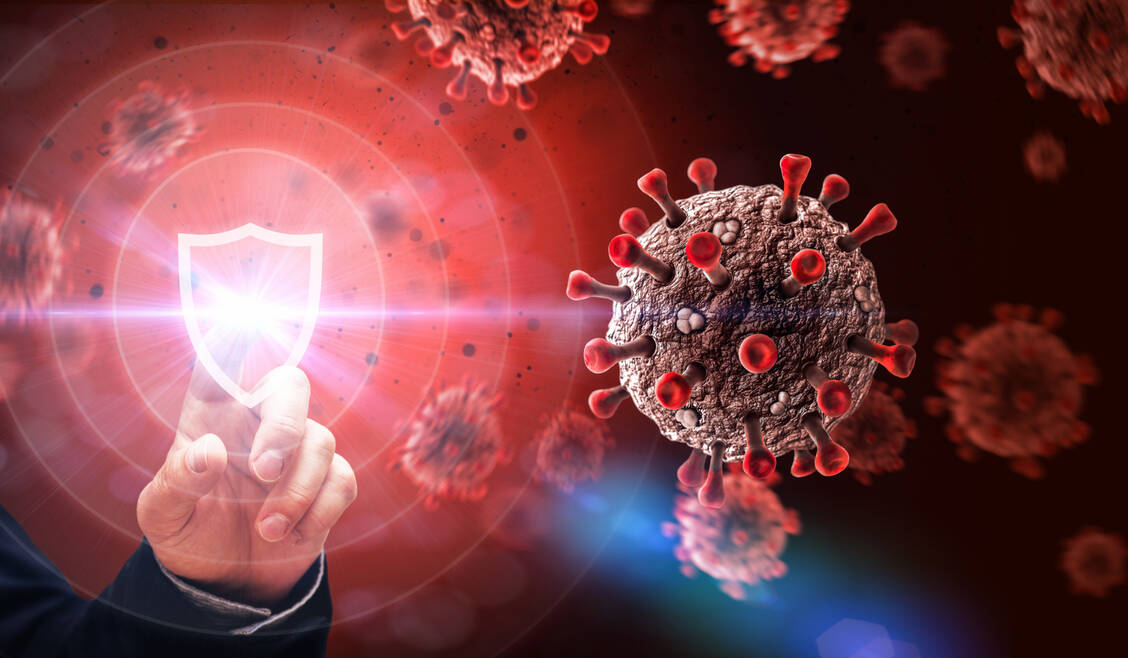Dies wurde mit dem Auftauchen der Omikron-Variante, die sich mit mehr als 30 Mutationen im Spike-Protein deutlich von allen anderen Virusvarianten unterschied, offensichtlich. In der Zeit vor Omikron hatte es nur sehr wenige Durchbrüche in der Studienkohorte gegeben und diese vor allem bei Personen, die immunnaiv geimpft worden waren. Mit dem Auftauchen von Omikron änderte sich das: Jetzt wurden Durchbruchinfektionen auch bei Personen gesehen, die eine Hybridimmunität entwickelt hatten, obwohl diese nach wie vor besser geschützt waren als die immunnaiv Geimpften. Daraus lässt sich ableiten, dass ein relativ stabiler Antikörpertiter gut ist, selbst wenn diese Antikörper nicht in der Lage sind, die neueren Varianten zu neutralisieren.