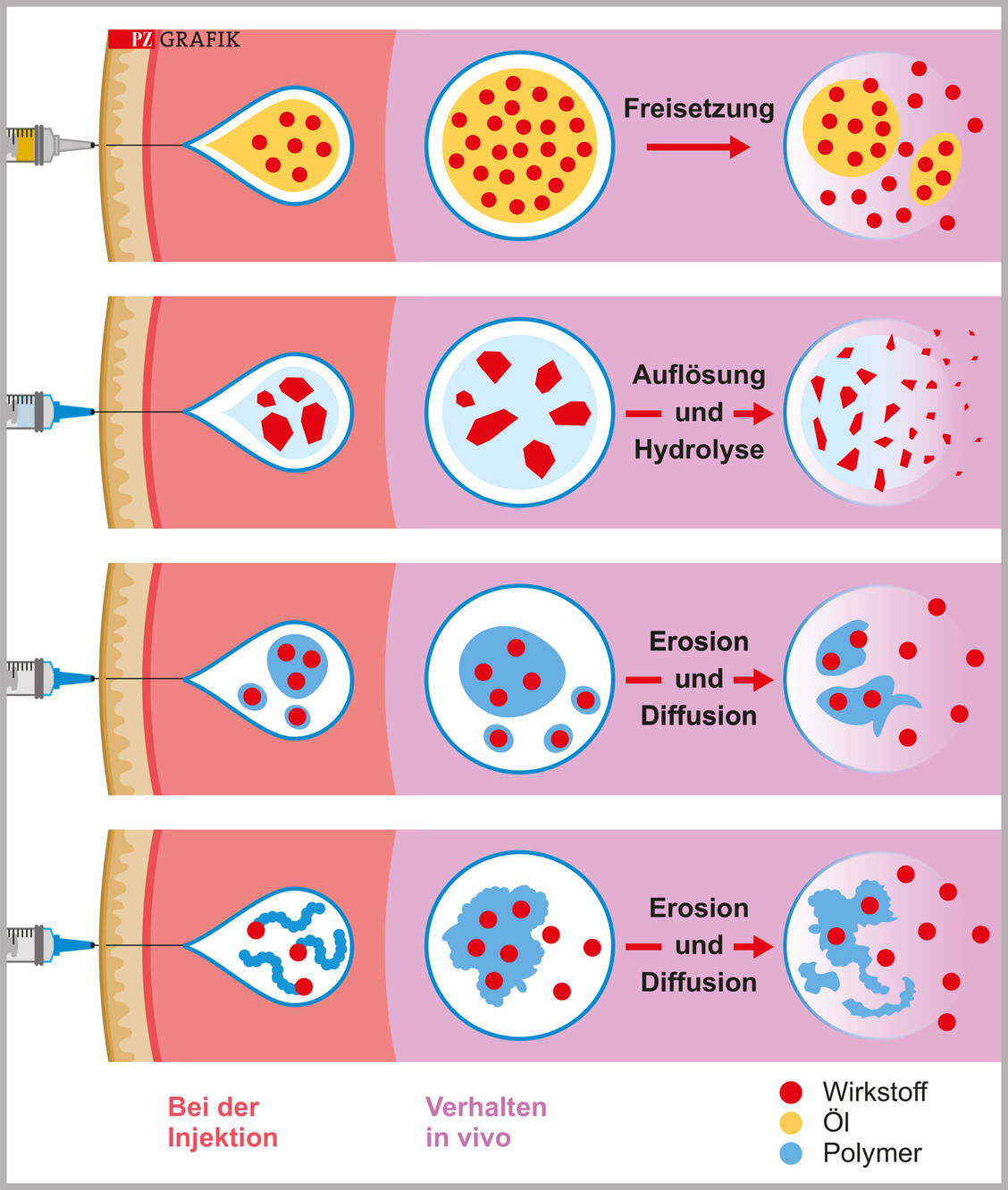Zu Beginn der Behandlung mit Depot-Antipsychotika kann eine initiale Booster-Dosis oder eine überlappende Gabe mit oralen Antipsychotika notwendig sein, um Serumspiegel im therapeu-tischen Bereich zu erreichen. Diese Strategien helfen, die Wirkung innerhalb der ersten Wochen zu erreichen, und minimieren so das Risiko von Rückfällen.
Ob dieses Boostern erforderlich ist, hängt von der Zeit bis zu Plasma-Spitzenspiegeln (tmax) ab, die zwischen den Präparaten stark variiert (Tabellen 3 und 4). Ebenso differiert die Zeit bis zum Erreichen des Steady State erheblich.
Bei Erstgenerations-Antipsychotika ist der Patient in der ersten Woche nach der Injektion engmaschig zu beobachten, ob die weitere orale Gabe noch erforderlich ist oder ob bei Fortsetzung der oralen Medikation bereits EPS auftreten.