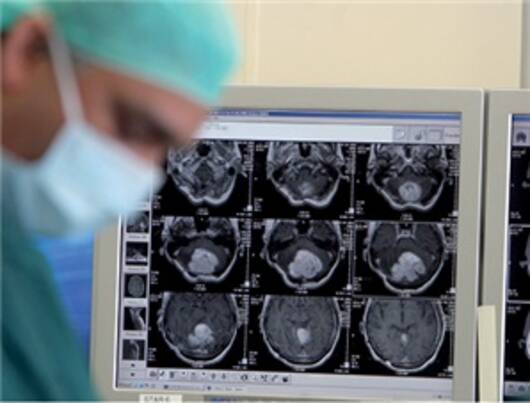Die Mastozytose zählt zu den seltenen Erkrankungen. Unter den Patienten befinden sich sowohl Kinder als auch Erwachsene. Typischerweise unterscheiden sich die Verlaufsformen in beiden Altersgruppen. Die reine Hautmastozytose ist eine ausschließlich dermatologische Erkrankung unbekannter Ursache und tritt bei fast allen betroffenen Kindern auf. Sie kann spontan ausheilen, sich in seltenen Fällen aber auch im Erwachsenenalter als systemische Mastozytose manifestieren. Die systemische Mastozytose ist eine hämatologische Erkrankung und verläuft meist chronisch. Die Mastzellen vermehren sich hierbei übermäßig stark in einem oder in mehreren inneren Organen. Die Haut kann, muss aber nicht betroffen sein. Sehr selten treten weitere Formen wie die Mastzellleukämie auf, die in der Regel tödlich verläuft.
Zu den Leitsymptomen gehören die typischen Hauterscheinungen, die am ganzen Körper und in den Schleimhäuten entstehen können. Nur Gesicht, Kopfhaut, Handinnenflächen und Fußsohlen bleiben meistens verschont. »Es handelt sich um bräunliche Läsionen, die typischerweise jucken und Quaddeln bilden, wenn man darüberreibt«, erklärt Dr. Frank Siebenhaar von der Klinik für Dermatologie und Allergologie der Berliner Charité im Gespräch mit der Pharmazeutischen Zeitung. Bei der Diagnose wird diese auch als Darier-Zeichen bekannte Reaktion mitunter provoziert.
Das zweite Leitsymptom sind schwere allergische Reaktionen bis hin zum lebensbedrohlichen allergischen Schock. Typischerweise treten sie nach Auslösern wie einem Insektenstich auf. »Manchmal kann aber auch ein bestimmtes Lebensmittel, Medikament oder ein Umwelteinfluss wie eine Temperaturveränderung als Trigger fungieren«, sagt Siebenhaar. Ebenso sei ein psychischer Faktor wie Stress denkbar. Den Betroffenen wird geraten, stets ein Notfallmedikament bei sich zu tragen. Dabei kann es sich um Antihistaminika, Cortison oder auch Adrenalin handeln. Als drittes Leitsymptom tritt eine Vielzahl unspezifischer Beschwerden auf, die die Gefahr von Fehldiagnosen erhöhen können.
Biopsie meist unvermeidbar
Als Ursache für die systemische Mastozytose gilt eine erworbene Punktmutation, die zu einer Veränderung des KIT-Rezeptors führt. Dabei handelt es sich um einen Wachstumsfaktor-Rezeptor aus der Familie der Tyrosinkinasen. Er kommt in der Zellmembran verschiedener Körperzellen vor, darunter auch die der Mastozyten. Wird er durch den Stammzellfaktor aktiviert, löst dies unter anderem die Vermehrung der Mastzelle aus. Bei der Punktmutation kommt es zu einer dauerhaften Aktivierung und damit zu einer unkontrollierten Vermehrung und einer ständigen Ausschüttung von Stoffen. KIT-Mutationen gelten auch als Auslöser verschiedener Krebserkrankungen.
Der Zusammenhang mit dem KIT-Rezeptor könnte erklären, warum die Hautläsionen braun sind. Der Experte dazu: »Wir nehmen an, dass der KIT-Rezeptor nicht nur auf den Mastzellen, sondern auch auf den Melaninzellen ausgebildet wird. Wird er aktiviert, vermehren sich die Melanozyten ebenfalls, sodass es zu einer verstärkten Pigmentierung kommt.«