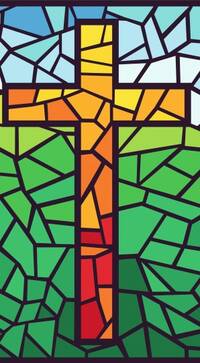Ziel von Palliative Care sei es, die Lebensqualität von Patienten, die mit einer lebensbedrohlichen Erkrankung konfrontiert sind, und ihren Angehörigen zu verbessern. Neben körperlichen Problemen quälen auch seelische, psychosoziale und spirituelle Sorgen und Nöte die Menschen. Diese vier Ebenen sind im Konzept von »Total pain« erfasst. »In der Betreuung schwer kranker Menschen und ihrer Angehörigen darf keine Ebene fehlen«, sagte der evangelische Pfarrer. Begleiter müssen auf jeden Patienten individuell eingehen und seine Bedürfnisse und Nöte erkennen. Das zeigte Roser an Beispielen.
So habe ein 69-jähriger Mann mit metastasiertem Darmkrebs, starken Schmerzen und Unruhe im Erstgespräch gebeten, seine Frau nicht über das Fortschreiten seiner Erkrankung zu informieren, um sie nicht zu belasten. »Doch was bedeutet es für Eheleute, wenn sie nicht mehr offen miteinander sprechen können«, fragte Roser. Wie schwer laste Ungewissheit auf der Seele? Und wie schwer wiege es am Lebensende, »letzte Dinge« nicht gemeinsam regeln zu können? Solche Themen müssten behutsam angesprochen werden.
Ein weiteres Beispiel: Eine 29-jährige Frau mit fortgeschrittenem Darmkrebs habe nur eine ambulante Chemotherapie akzeptiert, da sie sich mit ihrem Lebenspartner weiter um ihre kleine Tochter kümmern wollte. Ihre unsäglichen Schmerzen hingen stark mit der Angst um ihr Kind zusammen, berichtete Roser. Vorrangige Aufgabe des Palliative-Care-Teams war es, die soziale Situation und das Sorgerecht für das Kind zu klären. Dies half der Patientin sehr. Zudem belastete die Erkrankung das Selbstwertgefühl der jungen Frau enorm. Die Rollen als Mutter, Ernährerin der Familie, Partnerin und Frau: Alle stelle der Krebs infrage.
In der psychosozialen Begleitung gehe es um die Stärkung des Selbstwertgefühls, um Anerkennung der Lebensleistung – »jeder Mensch, auch ein Säugling, hat eine Lebensleistung vollbracht« – und um Verringerung der Isolation. Die Begleiter könnten helfen, familiäre Beziehungen zu klären, Bewältigungsstrategien unterstützen und Ressourcen mobilisieren. Schließlich gehe es um neue Lebensperspektiven, verdeutlichte Roser.
Er hält es für sehr wichtig, den Menschen Offenheit für tabuisierte Themen wie Trennung, Angst und Tod zu signalisieren. Dies gelte auch für Apotheker, denn zu diesen bestünden häufig langjährige Beziehungen. »Sie haben manchmal mehr Einblick als viele Angehörige oder der Seelsorger.« Der Referent ermutigte die Zuhörer, sich zu vernetzen und die nötigen kommunikativen Kenntnisse beispielsweise in Hospizhelfer- oder Fortbildungskursen zur Palliativpharmazie zu trainieren. »Das Gespräch ist nicht zu ersetzen durch Nachschlagen im Internet.«
Spiritualität und Religion helfen, bewusster mit dem Leben umzugehen, Zufriedenheit und inneren Frieden zu finden, so die Erfahrung des Theologen. Dabei habe die Spiritualität eines Menschen nicht immer mit Religion zu tun. Sie bestehe häufig aus einem Patchwork verschiedener kultureller, ethnischer und religiöser Einflüsse, die von einem individuellen Faden zusammengehalten werden. In Krisenzeiten werde dieser oft brüchig. Es gehe darum, den Faden zu stärken.
Der »palliative Blick« des Seelsorgers richte sich meist schnell auf die Vergangenheit, sagte Roser. »Wir wollen an vorhandene Ressourcen anknüpfen, das Kleine fördern und stärken.« Manche Menschen hätten einen starken Bezug zur Natur oder Kindheitserinnerungen, an die man anknüpfen könne. Auch vertraute Rituale, zum Beispiel beim Zubettgehen oder Zubettbringen der Kinder, Lieder oder Gebete können helfen, Kraftquellen und inneren Frieden zu finden. »Pflegen Sie Ihre eigene Spiritualität«, schloss Roser.