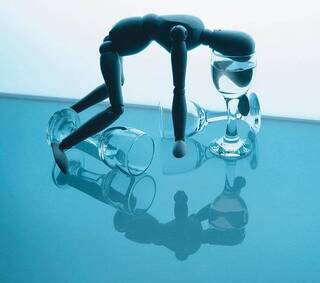Komasaufen, Trichtersaufen oder neudeutsch Binge-Drinking: Risikofaktoren dafür sind dem Referenten zufolge unter anderem ein niedriger sozialer Status, viel Taschengeld und exzessiv konsumierende Peers, also die Gruppe Gleichaltriger und Gleichgestellter im Umfeld. »Die Mehrheit konsumiert aus hedonistischen Motiven wie Genuss und Stimmungssteigerung«, informierte Thomasius. Eine kleine Gruppe von 5 bis 10 Prozent funktionalisiere die Drogen bereits in diesem Lebensalter um, damit sie zum Beispiel mit den Lebensverhältnissen besser zurechtkommt.
Die Folgen des Drogenkonsums sind weitreichend. Thomasius beleuchtete vier Aspekte. Als Erstes nannte er das Phänomen der Neurodegeneration. Während man früher gedacht hat, dass es nur nach langjährigem Alkoholkonsum dazu kommt, weiß man heute, dass dem nicht so ist. Untersuchungen zeigen, so Thomasius, dass bereits in der Adoleszenz im Bereich der Hirnrinde und auch in tiefer liegenden Bereichen bei Drogenkonsumenten neuronale Degeneration stattfindet. Und: Je höher der Konsum, desto niedriger die Substanzmenge im präfrontalen Cortex. Das Problem ist nicht auf Alkohol beschränkt: Auch Cannabis und zum Beispiel Ecstasy verursachen Neurodegeneration. »Ecstasy-Konsumenten haben signifikant weniger Serotonin-Transporter«, sagte der Mediziner. Das sei ein Hinweis auf serotonerge Neurodegeneration.
Beim zweiten Aspekt ging Thomasius darauf ein, dass das Suchtgedächtnis bei Kindern und Jugendlichen viel empfindlicher anspricht als bei Erwachsenen. Deswegen sei das Einstiegsalter ein bedeutender Risikofaktor. Eine wichtige Aufgabe in der Prävention sei es daher, den Einstieg so weit wie möglich in die Adoleszenz zu verschieben.
Drittens machte Thomasius auf Reifungsstörungen des Gehirns aufmerksam. Insbesondere tierexperimentelle Untersuchungen zeigten, dass zum Beispiel Cannabis die Bildung von Nervenzellverbänden blockiert und sich bestimmte Nervenbahnen nicht richtig entwickeln. Das seien vor allem Strukturen, die für die Emotionskontrolle äußerst wichtig sind.
Last but not least kann der Substanzmissbrauch zu Identitätsstörungen führen. »Das Durchlaufen der Etappen einer Persönlichkeitsentwicklung bleibt stecken«, beschrieb Thomasius diesen Sachverhalt.
Am Ende seines Vortrages ging er auf Erfolg versprechende Präventionsmaßnahmen ein. Thomasius bedauerte, dass viele Möglichkeiten in Deutschland bislang nicht genutzt werden. Einer Untersuchung zufolge seien Maßnahmen zur Regulierung der Verfügbarkeit von Alkohol (etwa Mindestalter und Beschränkung der Verkaufszeiten) und Preisgestaltung viel effektiver als das, »was wir in der Schule an Prävention machen«. Ferner seien auch die Maßnahmen gegen Alkohol am Steuer effektiv. »Deutschland hat das am besten entwickelte Suchtberatungssystem«, sagte der Mediziner. Leider gelte das nicht für Kinder und Jugendliche. In der Zukunft müssten die Behandlungsmöglichkeiten, sowohl ambulant als auch stationär, erweitert werden.