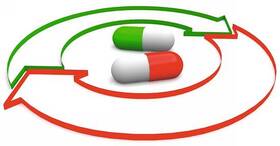Bei den Glucocorticoiden spielen Griese zufolge in der Praxis vor allem pharmakodynamische Wechselwirkungen eine Rolle. So sei es eindeutig, dass die gleichzeitige Einnahme von Glucocorticoiden und nicht-steroidalen Antirheumatika (NSAR) das Risiko für gastrointestinale Blutungen und Magenulcera erhöht. Dieses sei bei allen NSAR vermutlich gleich hoch, bestehe bereits nach einer Woche der parallelen Einnahme und betreffe auch magensaftresistente Formulierungen und Suppositorien. Bei längerer gemeinsamer Gabe sollte man an eine Ulkus-Prophylaxe mit einem Protonenpumpenhemmer denken oder Alternativen zu NSAR in Betracht ziehen. Die kurzfristige Gabe von NSAR (bis zu drei Tage oder bei Bedarf) hält Griese für möglich, solange aktuell kein Magengeschwür besteht oder früher einmal auftrat. Ein Wechsel auf Paracetamol in der Selbstmedikation bringt übrigens vermutlich nichts. »Sein Interaktionspotenzial ist aufgrund der aktuellen Datenlage nicht abschließend beurteilbar, ein erhöhtes Ulkus-Risiko ist aber auch hier wahrscheinlich«, fasste Griese zusammen.
Glucocorticoide können auch die Blutzuckerwerte ordentlich in die Höhe treiben. Das gilt nicht für die topische Anwendung, sondern nur für die systemische Gabe und die Inhalation sehr hoher Dosen. Diese Stoffwechselentgleisungen sind in den ersten Tagen nach Einnahme, aber auch noch nach mehreren Wochen möglich. Griese machte deutlich, dass bei längerer gemeinsamer Gabe von Insulin und systemischen Glucocorticoiden zu Beginn, bei Dosisänderung und am Ende der Corticoid-Therapie der Blutzuckerspiegel über mehrere Wochen sorgfältig überprüft werden muss.
Ein Risikopotenzial bei Diabetikern, die mit Insulin behandelt werden, bergen vor allem die nicht-kardioselektiven Betablocker, da diese eine durch Insulin ausgelöste Unterzuckerung verstärken und verlängern können. Besonders tückisch ist darüber hinaus, dass typische Hypoglykämie-Warnzeichen, etwa Unruhe, Tremor oder Herzklopfen, in diesem Fall ausbleiben.
»Für Schilddrüsenhormone sind wenige Interaktionen beschrieben«, sagte Griese. Die Komplexbildung mit polyvalenten Kationen erfordert die Levothyroxin-Einnahme im zeitlichen Abstand zu Calcium, Magnesium und Co. Weniger bekannt ist die Wechselwirkung mit oralen Antikoagulanzien wie Phenprocoumon und Warfarin. »Jede Veränderung des Schilddrüsenhormon-Status kann zu Veränderungen der Blutgerinnung führen«, warnte Griese. Die blutgerinnungshemmende Wirkung der Vitamin-K-Antagonisten kann zu Beginn einer Behandlung mit Schilddrüsenhormonen oder bei einer Dosiserhöhung innerhalb von einigen Tagen zunehmen. Die Folge: Das Blutungsrisiko steigt. Bei jeder Veränderung der Schilddrüsenhormontherapie sollte der Referentin zufolge deshalb bei den betreffenden Patienten die Blutgerinnung besonders engmaschig überwacht werden. Zudem können Apotheker die Patienten darauf hinzuweisen, dass Therapietreue in diesem Fall umso wichtiger ist. Ferien von den Schilddrüsenhormonen könnten fatale Folgen haben.
Die häufigsten Interaktionsmeldungen, die hormonale Kontrazeptiva betreffen, erfolgen zur Kombination mit Antibiotika beziehungsweise Johanniskraut. Laut Griese ist es nach der aktuellen Datenlage eher unwahrscheinlich, dass die empfängnisverhütende Wirkung durch diese Kombinationen vermindert wird. Darauf verlassen kann frau sich aber nicht. »Wer auf der sicheren Seite sein möchte, sollte über zusätzliche Verhütungsmaßnahmen, zum Beispiel während der Antibiotika-Therapie und den darauf folgenden sieben Tagen, nachdenken«, so Griese.