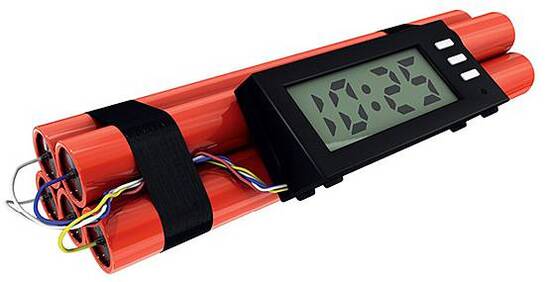Alkohol und Nicotin tabu
Neben den Genen stellt der Lebenswandel einen wichtigen Risikofaktor für eine chronische Pankreatitis dar, insbesondere ein hoher Alkoholkonsum und Rauchen. »Bei 80 Prozent der Patienten mit chronischer Pankreatitis liegt ein Alkoholabusus vor und von diesen rauchen auch nahezu alle«, sagte Mössner. Alkohol- und Nicotinkarenz sind daher die wichtigsten Maßnahmen für Betroffene, doch ist das in den meisten Fällen leichter gesagt als getan. »Auf den Alkohol zu verzichten, schaffen die meisten, mit dem Rauchen aufzuhören, fast keiner«, berichtete Mössner.
Die chronische Pankreatitis verläuft in Schüben, bei denen immer mehr Pankreasgewebe nekrotisiert und zu Bindegewebe umgebaut wird. Die Nekrosen können sich entzünden, weshalb eine Zeit lang die prophylaktische Gabe von Antibiotika bei jedem Schub propagiert wurde. Von diesem Konzept ist man allerdings mittlerweile abgekommen, da ein Vorteil nicht belegt werden konnte. »Lediglich bei zu erwartender Infektion und ausgedehnter Nekrotisierung können prophylaktisch Carbapeneme gegeben werden«, informierte der Gastroenterologe.
Produziert der Patient nicht mehr in ausreichendem Maß Verdauungsenzyme, spricht man von einer exokrinen Pankreasinsuffizienz. Die Enzyme müssen dann in Tabletten- oder Kapselform ersetzt werden. Diese sind zum Essen einzunehmen, um eine Durchmischung mit dem Nahrungsbrei zu gewährleisten.
Das empfindlichste Enzym ist dabei die zur Fettverdauung benötigte Lipase. Sie ist säureempfindlich, wird also bei pH-Werten unter 4 zerstört. Wird sie in zu großen Kapseln oder Tabletten verabreicht, bleiben diese im Magen liegen, »während der Schweinebraten unverdaut bereits den Dünndarm passiert hat«, so Mössner. Magensaftresistente Darreichungsformen, die das Enzym in Mikrotabletten oder -pellets enthalten und diese im Duodenum rasch freisetzen, sind daher erforderlich.
Diabetes als Folgeerkrankung
In Deutschland sind fünf Präparate zur Pankreasenzym-Substitution verfügbar: Kreon®, Pangrol®, Panzytrat®, Ozym® und Pankreatin-ratiopharm®, von denen das erste mit Abstand am häufigsten verordnet wird. Wirksamkeitsvergleiche zwischen den verschiedenen Präparaten im Rahmen prospektiver, randomisierter und doppelblinder Studien gibt es laut dem Referenten keine. Diese würden eine fettnormierte Diät sowie eine Fettmessung im Stuhl der Teilnehmer voraussetzen und wären damit sehr aufwendig. Als Faustregel für die Dosierung nannte Mössner eine Dosis von mindestens 200 000 I.E. Lipase pro Tag.
Da in den Inselzellen des Pankreas auch Insulin synthetisiert wird, ist Diabetes eine weitere mögliche Folge der fortschreitenden Zerstörung der Bauchspeicheldrüse. »Man spricht in diesem Fall von einem Typ-3c-Diabetes«, informierte Mössner. Obwohl ein absoluter Insulinmangel vorliegt, sei eine Insulinsubstitution zur Verhinderung von Spätschäden jedoch nicht in jedem Fall indiziert, da die Patienten aufgrund ihres Lebenswandels meist eine stark verkürzte Lebenserwartung haben.