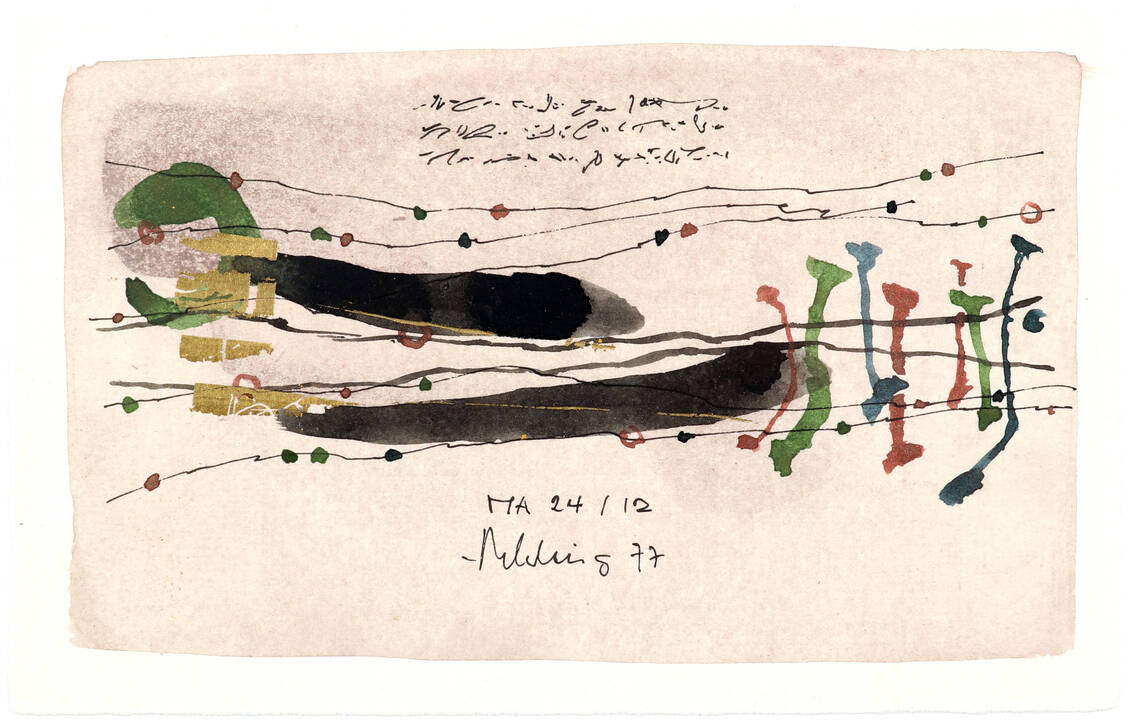Entdeckt und gefördert wurde er in den 1960er-Jahren zunächst in Holland. Künstlerfreunde empfahlen Mehling an die einflussreiche Galerie »Het Kunstcentrum« in Den Haag. Sie stellte bis zu ihrer Schließung 1974 mehrfach seine Arbeiten mit großen Erfolgen aus, ebenso wie weitere holländische Galerien und Museen.
Besprechungen namhafter Kunsthistoriker und Kunstkritiker folgten; sie rieten der deutschen Kunstwelt dringend, diesen Landsmann näher kennen zu lernen. Der Kunsthistoriker und Essayist Hans Redeker (1918 bis 1992) sah in ihm eine der »größten Offenbarungen unserer Zeit«; er habe längst das Recht auf internationalen Rang (1966). Der in Köln lebende Horst Richter (1926 bis 2018), unter anderem langjähriger Präsident des Internationalen Kunstkritikerverbandes, war von dem »rasche[n] Aufstieg eines professionellen Outsiders« (1968) tief beeindruckt; ebenso der Niederländer Dolf Welling (1919 bis 2015): »...der kam einfach so vom Mond gefallen...« (1974).
Mit dem Arzt und Kunstsachverständigen Peter Beckmann (1908 bis 1990), Sohn des Malers Max Beckmann (1884 bis 1950), verband ihn eine enge Freundschaft. Beckmann förderte Mehling und sprach auf vielen seiner Ausstellungen. Der Philosoph und Wissenschaftstheoretiker Max Bense (1910 bis 1990) betrachtete die Malerei Mehlings 1985 in einer kunsttheoretischen Besprechung unter dem Begriff der »ästhetischen Realität«. Bense sprach auch zur Ausstellungseröffnung 1987 in Kornwestheim.