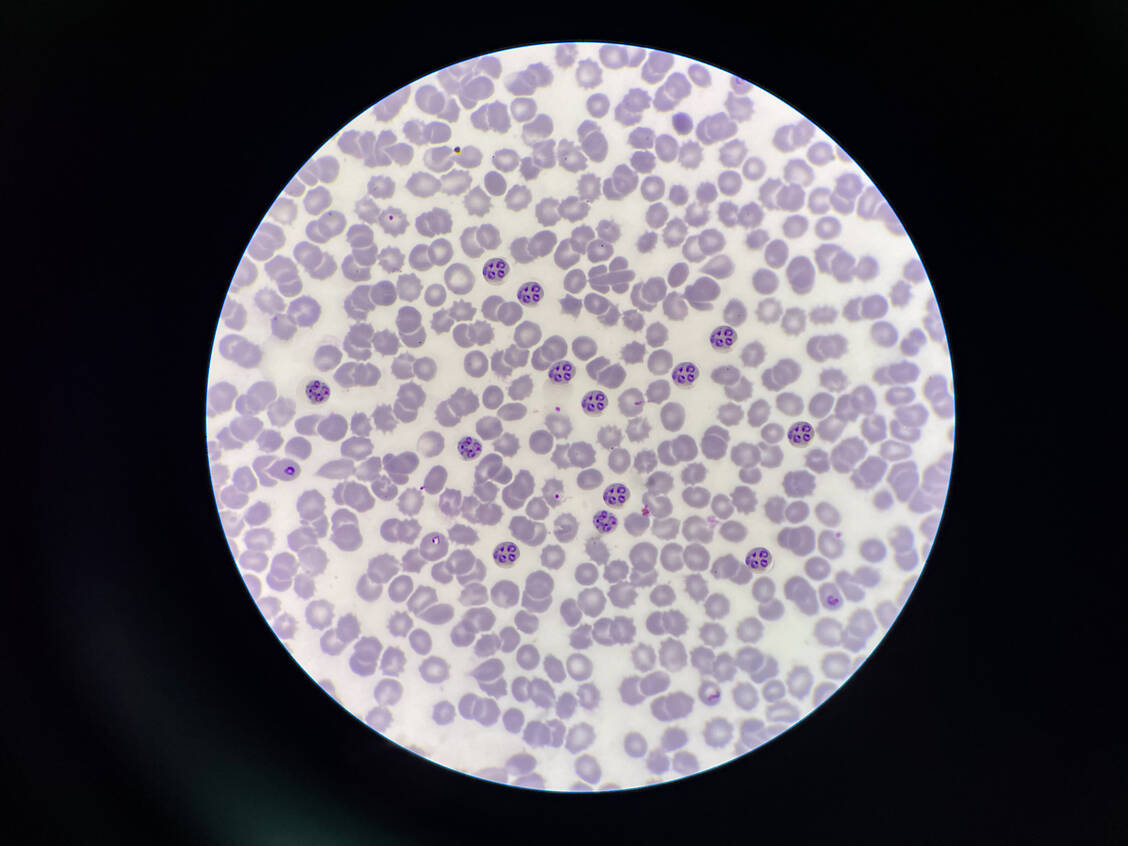Bereits seit vielen Jahren ist intravenöses Artesunat der weltweite Standard für die Erstlinientherapie von schwerer Malaria. Studien zeigen, dass die initiale intravenöse Behandlung mit Artesunat bei der Senkung des Sterberisikos hospitalisierter Patienten mit schwerer Malaria wirksamer ist als eine parenterale Behandlung mit Chinin.
Seit November gibt es erstmals ein Medikament mit Artesunat auch in Deutschland. Die Einstufung als Sprunginnovation kommt damit mit gehöriger zeitlicher Verspätung, denn Artesunat ist alles andere als neu und unbekannt. Dennoch ist es wichtig, dass das Medikament auch hierzulande für die initiale Behandlung von schwerer Malaria bei Erwachsenen und Kindern zugelassen und verfügbar ist. Jährlich wird bei etwa 1250 Personen in Europa eine schwere Malaria diagnostiziert. Meistens handelt es sich um Militärangehörige, die in Malaria-Endemigebieten eingesetzt sind oder um zivile Reisende, die von einem Besuch in einer solchen Region zurückkehren.
Seine ganz große Rolle spielt der Wirkstoff Artesunat aber nicht in Europa, sondern auf anderen Kontinenten. Jedes Jahr sterben mehr als 400.000 Menschen an Malaria, wobei die Bevölkerung in den afrikanischen Ländern südlich der Sahara am stärksten betroffen ist. Zu Recht wurde der Wirkstoff schon vor mehr als 20 Jahren von der WHO in die Liste der unentbehrlichen Arzneimittel aufgenommen.
Sven Siebenand, Chefredakteur