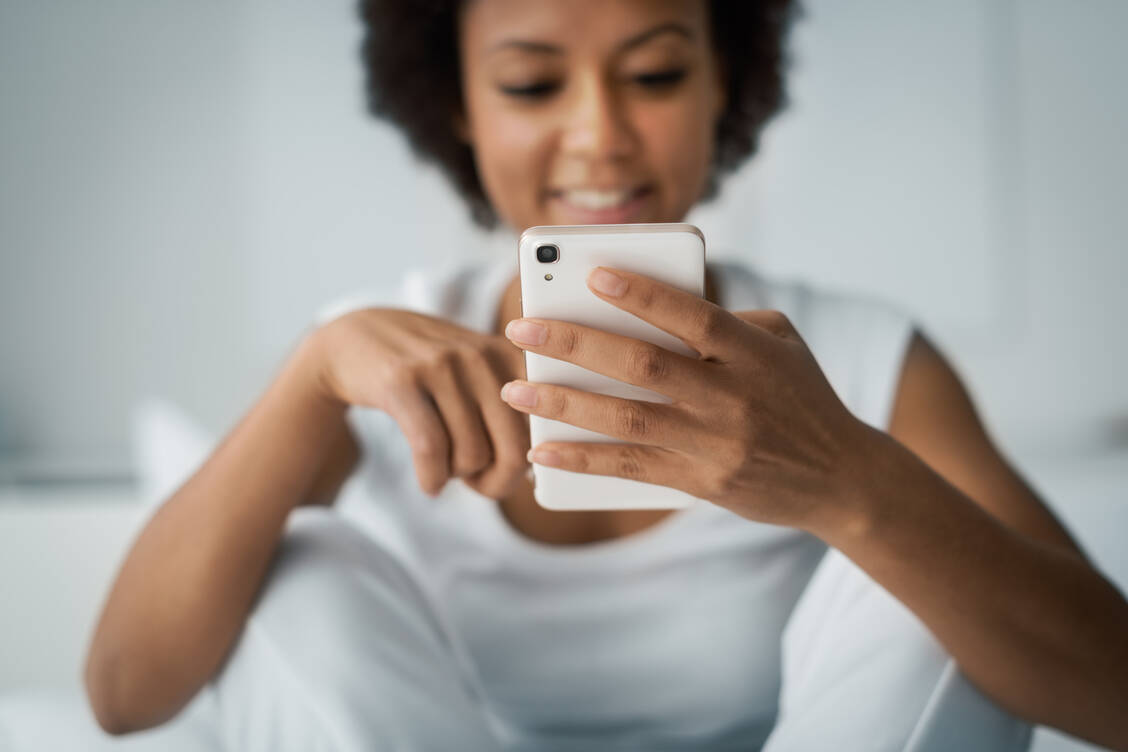Spahn sagte der »Rheinischen Post« (Montag), die Entwicklungszeit sei gebraucht worden, um hohe Anforderungen zu erfüllen. »Die App muss auf allen Endgeräten genutzt werden können und soll beispielsweise auch dann messen, wenn man mit dem Handy Musik hört.« Hinzu kämen Vorgaben bei Datenschutz, Datensicherheit und Energieeffizienz. »Eine App, die in wenigen Stunden den Akku des Handys leerzieht, nutzt keiner.« Er wolle vermeiden, dass die App von vielen wieder gelöscht werde, weil sie zu viel Energie fresse. »Wenn wir in den kommenden Wochen einige Millionen Bürger von der App überzeugen, dann bin ich schon zufrieden«, sagte Spahn weiter. »Das Virus einzudämmen, ist ein Teamspiel. Jeder, der die App herunterlädt, hilft dabei.« Die Bundesregierung wolle in einer breiten Kampagne für die Nutzung werben.