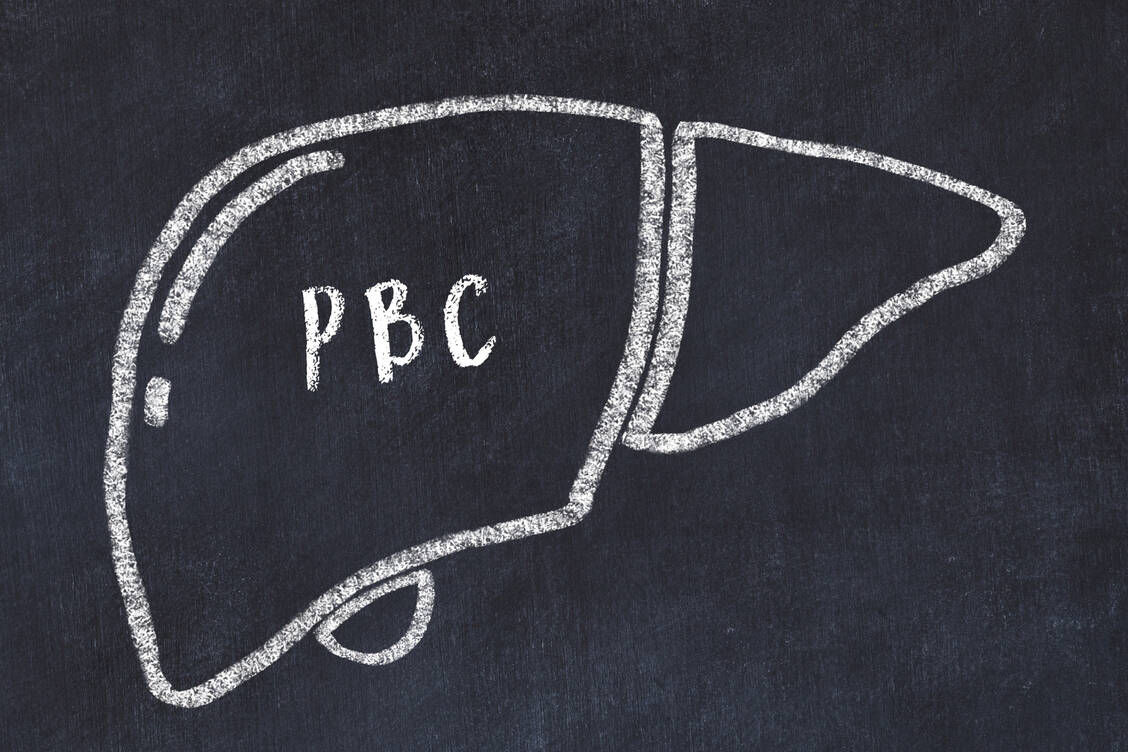Mittel der ersten Wahl in der Behandlung der PBC ist Ursodesoxycholsäure (UDCA). Viele Betroffene sprechen auf dieses Pharmakon allerdings nicht oder nicht ausreichend an. Vor einigen Jahren kam mit Obeticholsäure eine Behandlungsoption mit einem neuen Wirkprinzip auf den Markt. Die Substanz ist indiziert zur Kombinationstherapie mit UDCA bei Patienten, die unzureichend auf die Standardtherapie ansprechen, oder als Monotherapie bei Patienten, die UDCA nicht vertragen. Obeticholsäure bindet an den Farnesoid-X-Rezeptor, ein wichtiger Regulator für Gallensäure-, Entzündungs-, Fibrose- und Stoffwechselwege. Aber auch auf Obeticholsäure sprechen nicht alle Betroffenen an. Zudem ist vermehrter Juckreiz ein Problem und seit 2022 ist der Wirkstoff bei dekompensierter Leberzirrhose oder bei vorheriger hepatischer Dekompensation kontraindiziert.