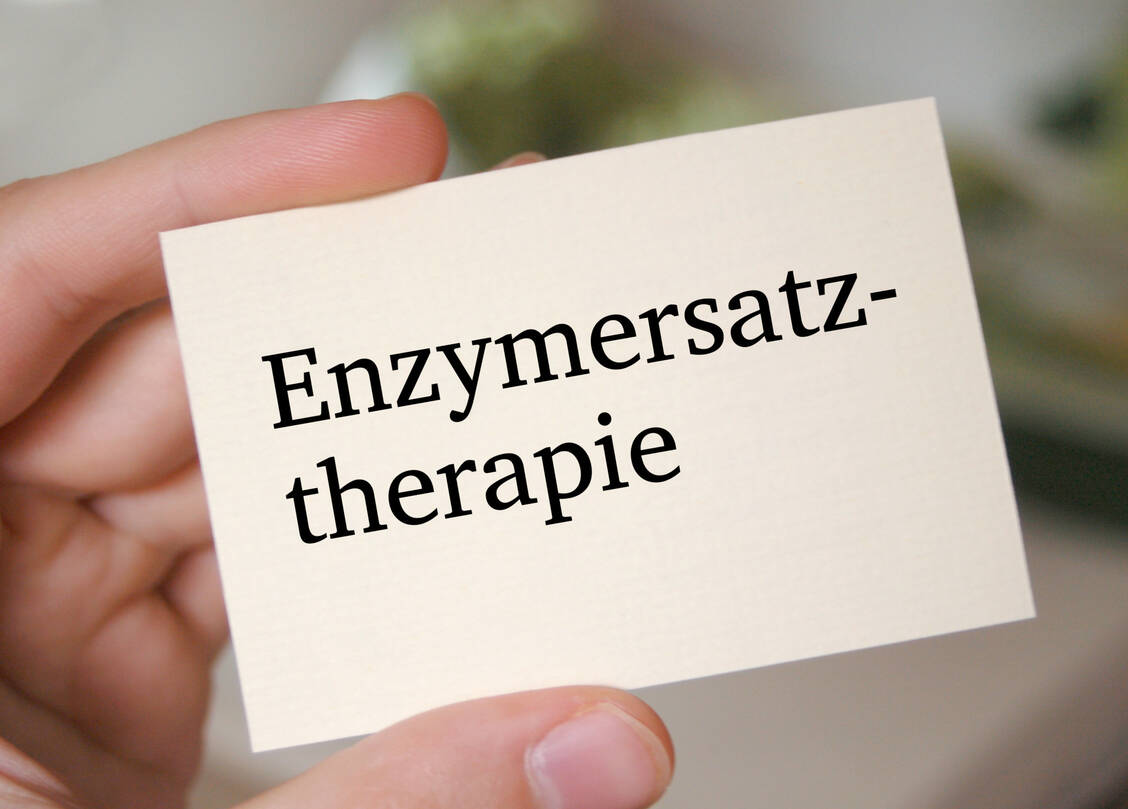Menschen mit Morbus Pompe haben niedrige Werte des Enzyms saure α-1,4-Glucosidase (GAA), was zu einer Anreicherung von Glykogen und damit zu irreversiblen Schäden an Skelett- und Herzmuskeln führt. Avalglucosidase alfa ist so konzipiert, um an den Mannose-6-Phosphat (M6P)-Rezeptor zu binden, über den die Aufnahme der Enzymersatztherapie in die Zellen und der Transport zum Lysosom erfolgt. Das Molekül weist im Vergleich zu Alglucosidase alfa einen durchschnittlich 15-fach höheren Anteil an M6P-Resten auf. Das soll dazu führen, dass Avalglucosidase alfa besonders gut in die Körperzellen aufgenommen und der Abbau von Glykogen in den Zielgeweben verbessert wird. In der COMET-Studie wurden die beiden Enzymersatztherapien gegeneinander getestet. Avalglucosidase alfa war Alglucosidase alfa im primären Endpunkt, der forcierten Vitalkapazität, nicht unterlegen. Eine statistische Überlegenheit wurde knapp verfehlt.