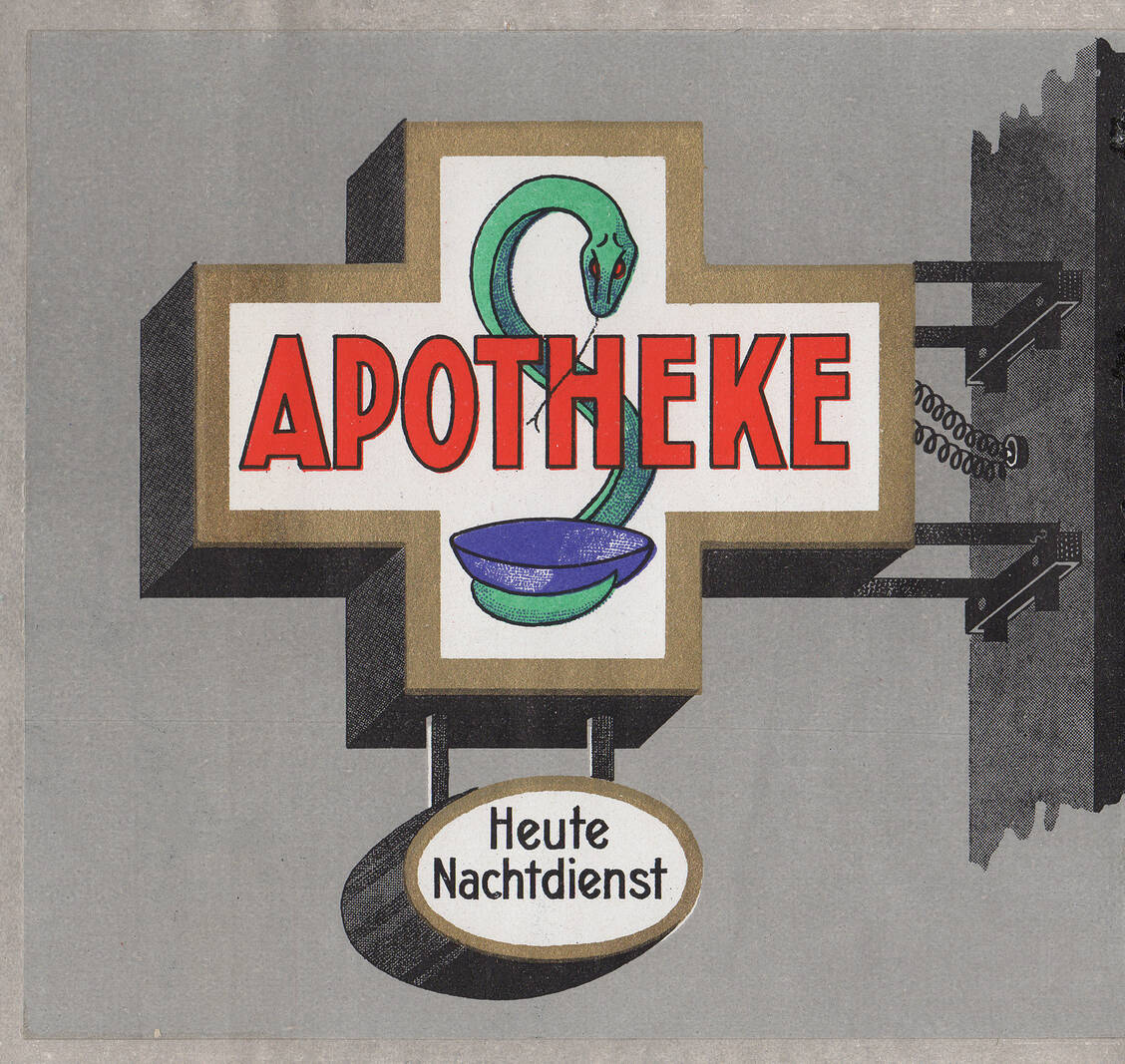Bis Anfang der 1930er Jahre nutzten 30 Prozent der Apotheken in Deutschland das Emblem als Wahrzeichen, schreibt das Apotheken-Museum. Zudem prangte es als Logo auf Etiketten und Rezepthüllen. Dann aber übernahmen die Nationalsozialisten die Macht, denen der moderne Stil des Bauhaus-ähnlichen Zeichens nicht passte. Somit waren auch die Tage der drei Löffel gezählt. Auch das Schweizer Kreuz stellte keine Alternative mehr dar, da die Nutzung inzwischen rechtlich beschränkt worden war.
Ausgeschrieben von den Deutschen Apothekern in der Zeitschrift »Gebrauchsgrafik«, gab es 1936 erneut einen Wettbewerb. Unter den Bedingungen im nationalsozialistischen Deutschland nahm damit die so genannte Lebensrune, ein germanisches, von den Nationalsozialisten zur Propaganda genutztes Zeichen, Einzug in die Symbolik rund um das Apotheken-Wahrzeichen. Sämtliche Gesundheitsverbände, etwa die der Ärzte und Zahnärzte, führten diese Rune bereits in ihren Logos.