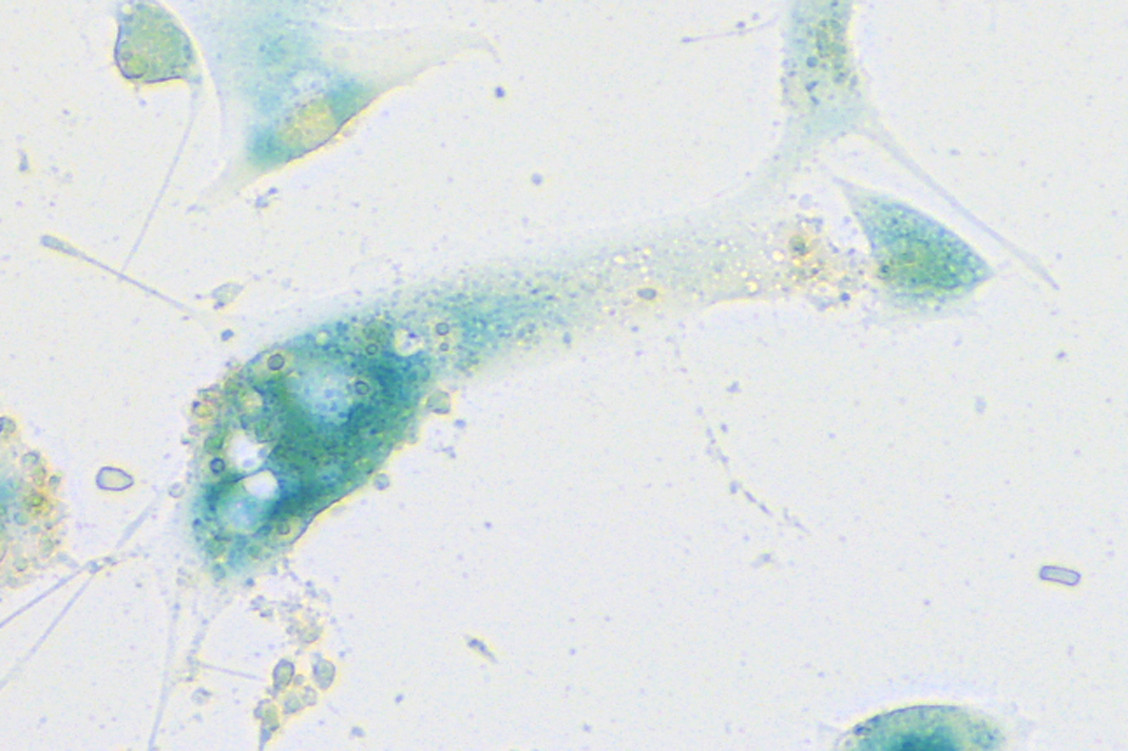Diese klaren Hinweise auf eine virusinduzierte Seneszenz von SARS-CoV-2 infizierten Zellen veranlassten die Wissenschaftler, über den Einsatz von sogenannten Senolytika, die gezielt seneszente Zellen beseitigen, nachzudenken. »Diese entzündliche Überreaktion frühzeitig mit spezifischen Wirkstoffen zu unterbrechen, hat in unseren Augen großes Potenzial, eine neue Strategie zur Behandlung von Covid-19 zu werden«, sagt Professor Dr. Clemens Schmitt, Direktor des Molekularen Krebsforschungszentrums an der Charité. Tatsächlich konnte das Team in Tiermodellen zeigen, dass die bekannten senolytische Wirkstoffe Navitoclax, Fisetin und Dasatinib/Quercetin selektiv VIS-Zellen eliminierten. Zudem mildern sie die Covid-19 induzierte Pneumonie und reduzieren die Entzündungsphänomene bei Hamstern und Mäusen, die mit SARS-CoV-2 infiziert waren.