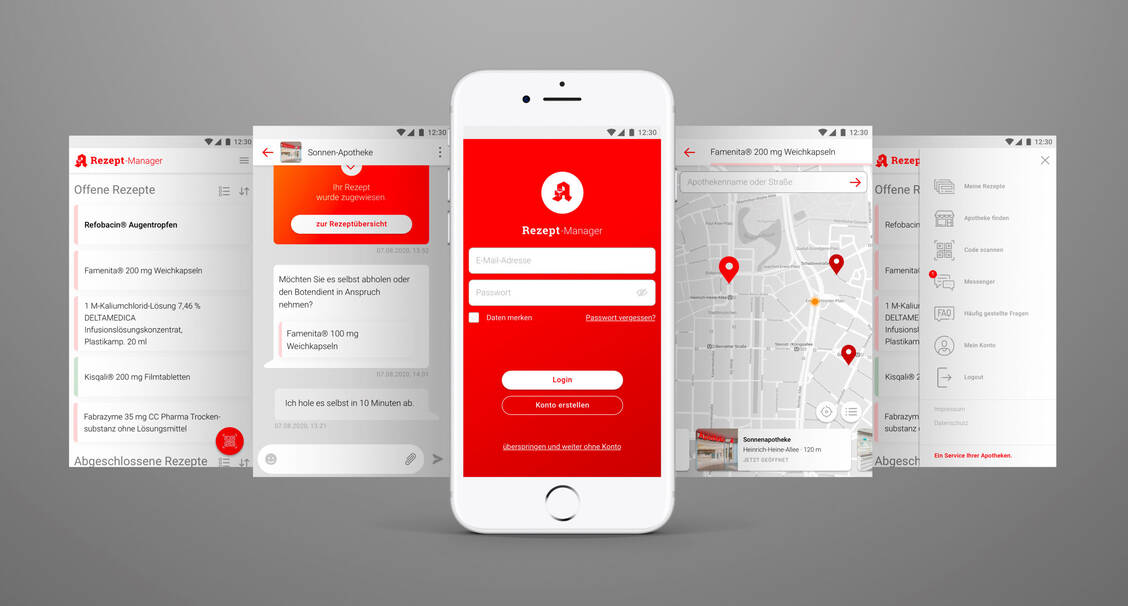Die E-Rezept-Struktur der Apotheker ist im Vergleich zu den anderen Marktplayern sicherlich die, in der am wenigsten wirtschaftliche Interessen zum Tragen kommen. Die Kassen haben keine Zugriffsrechte und die Interessen von Anlegern und neue Umsatzquellen beteiligter Konzerne spielen keine Rolle. Allerdings haben sich die Apotheker in ihrem Vorgehen auch etwas verschätzt: Ziel des DAV war es, dass der Gesetzgeber die Apotheker mit dem Aufbau eines nationalen Rezeptdienstes beauftragt. Inzwischen ist klar, dass dies eine Fehleinschätzung war. Sowohl der Gesetzgeber als auch das Ministerium wollen den Wettbewerb »hinter« einer Gematik-App ermöglichen. Klar ist aber auch, dass die Apotheker an der Entwicklung der App festhalten sollten, um sie gegen interessengeleitete Produkte zu positionieren.