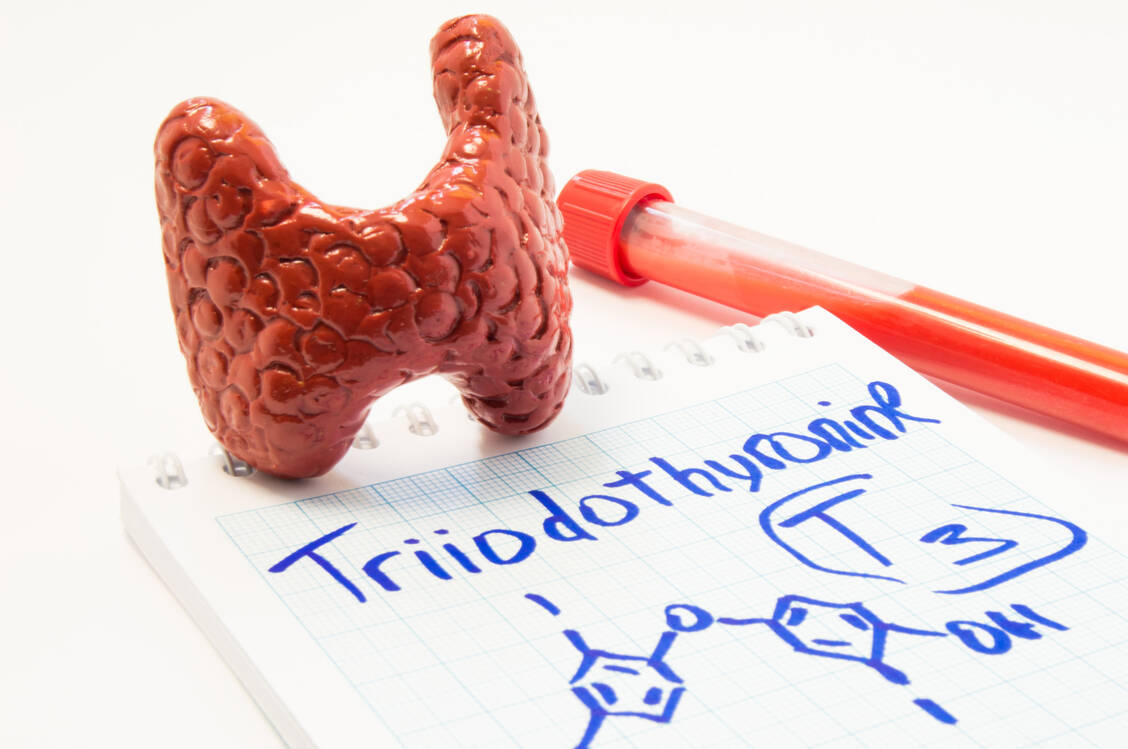Über zwei Hauptarten genetischer Ursachen ist etwas bekannt. Eine davon betrifft Mutationen in Faktoren, die notwendig sind, damit die Aminosäure Selenocystein in sogenannte Selenoproteine – zu denen auch die Dejodinasen gehören – eingebaut werden kann. Ohne Selenocystein können diese Proteine, einschließlich der Dejodinasen, nicht korrekt arbeiten. Diese Faktoren sind das Protein SBP2 (Selenocysteine insertion sequence binding protein 2) und eine spezielle Transfer-RNA (tRNA) namens TRU-TCA1-1, die Selenocystein beim Aufbau der Proteine an die richtige Stelle im Ribosom bringt. Werden SBP2 oder TRU-TCA1-1 wegen eines genetischen Defekts nicht korrekt oder nur stark vermindert gebildet, schränkt dies die Funktion der Dejodinasen ein, insbesondere bei den Unterarten D1 und D2. Diese können T4 dann nur unzureichend in T3 umwandeln.