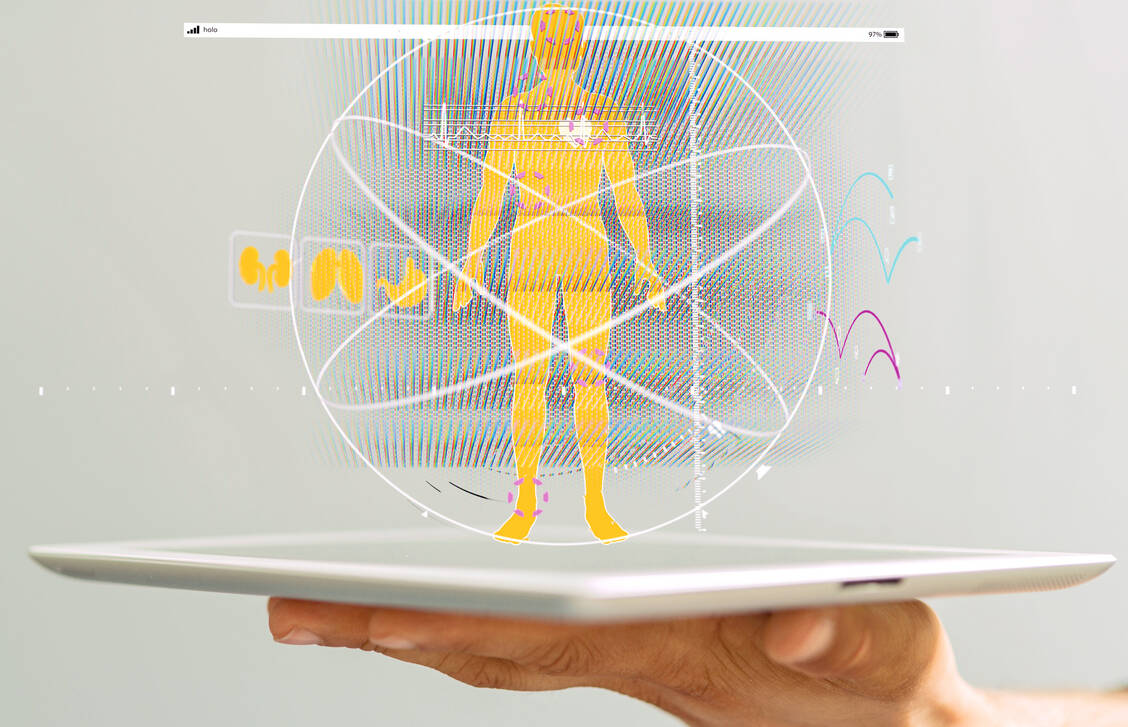1. Notfalldatensatz (NFD) bzw. Elektronische Patientenkurzakte (ePKA)
• Größe, Gewicht
• Vorerkrankungen (mit ICD 10)
• Aktuelle Dauermedikation (inkl. Bedarfsmedikation)
• Allergien (mit klinischen Angaben) und Unverträglichkeiten
• Angaben zu Implantaten
• Pflegestufe
• Einschluss in ein Patientenprogramm, z.B. DMP
• Kontaktinformationen Angehörige, Pflegeeinrichtung, behandelnde Ärzt:innen/Einrichtungen
2. Datensatz persönliche Erklärungen (DPE)
• Betreuungsverfügung, Vorsorgevollmacht, Betreuung (Kontaktdaten der Pflegeeinrichtung inkl. Pflegebögen), ggf. vorhandener Pflegegrad
• Patientenverfügung
• Organspendeausweis
3. Aktuelle Medikation
• Bundeseinheitlicher Medikationsplan (BMP), elektronischer Medikationsplan (eMP) und Angabe über Indikationen und Medikationshistorie
• Ggf. Interaktionscheck-Option
4. Impfdokumentation
• Impfpass
5. Briefe und Berichte
• Stationäre Behandlung
• Briefe ambulante Fachärzte
• Physiotherapeuten, andere Heilberufe
6. Befunde von
• Labor-Untersuchungen (z.B. Klinische Chemie, Hämatologie etc.)
• apparativen Untersuchungen (z.B. EKG, Lungenfunktion etc.)
• bildgebenden Verfahren (z.B. CT, MRT, Ultraschalluntersuchungen etc.)