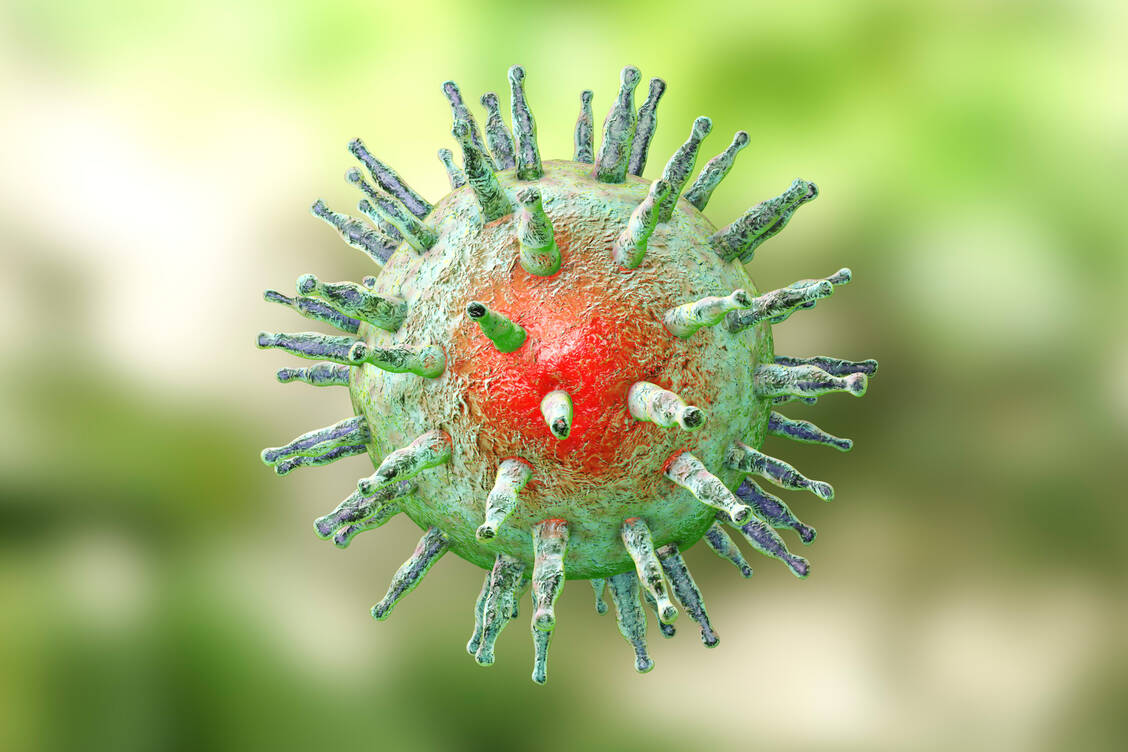Es ist das erste Virus, das mit der Entstehung von Krebs in Verbindung gebracht wurde. Das Epstein-Barr-Virus (EBV), ein DNA-Virus aus der Familie der Herpesviren, ist auch als Humanes Herpesvirus 4 (HHV4) bekannt. Entdeckt wurde es 1964 von den britischen Virologen Anthony Epstein und Yvonne Barr – in den entarteten B-Zellen eines Patienten mit Burkitt-Lymphom. Seit damals war also bekannt, dass EBV an der Krebsentstehung beteiligt sein kann. Heute weiß man: Das Virus spielt nicht nur beim Burkitt-Lymphom eine Rolle, sondern auch bei weiteren Krebsformen wie dem Hodgkin-Lymphom, beim seltenen, vor allem in Südostasien vorkommenden Nasopharynxkarzinom, verschiedenen Magenkarzinomen und bei den sogenannten Posttransplantations-Lymphomen (PTLD).