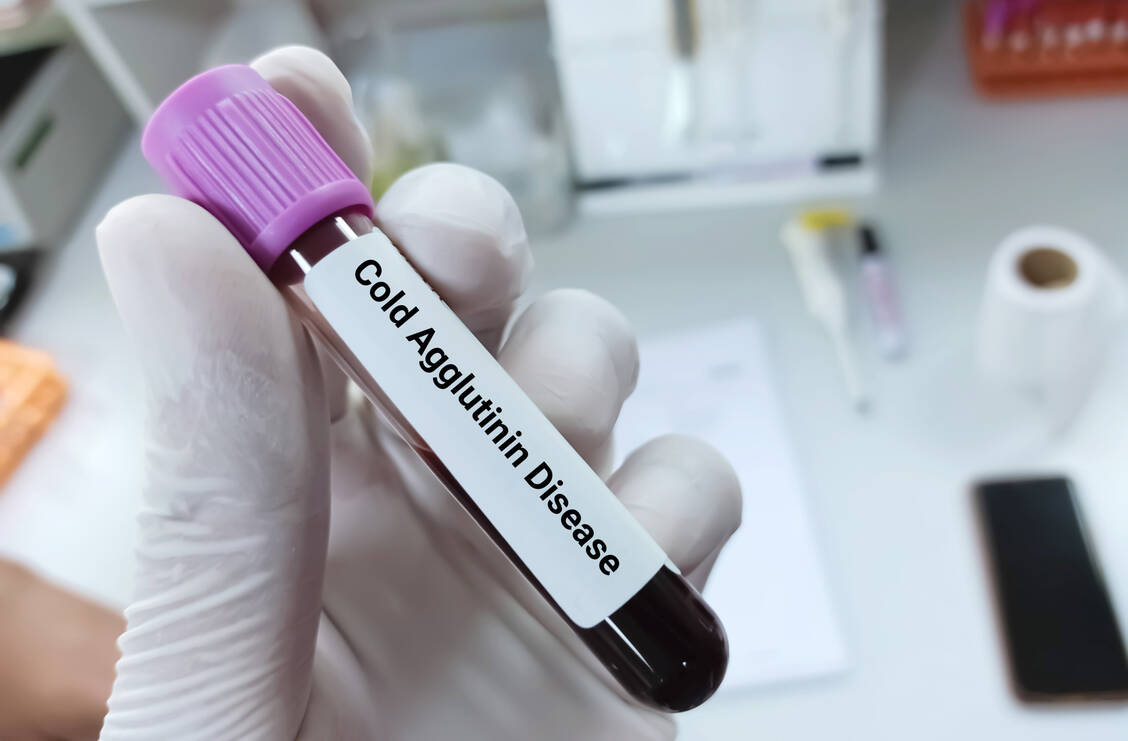Die Kälteagglutinin-Erkrankung (2, 3) ist eine seltene Autoimmunerkrankung. Bei niedrigen Temperaturen (0 bis 5 °C) binden IgM-Autoimmunantikörper an Erythrozyten und bedingen deren Agglutination sowie Hämolyse. Symptome wie Fatigue und chronische Anämie sind die Folge. Das Risiko von Thromboembolie und Mortalität ist erhöht. Äußerlich sichtbare Symptome sind Raynaud-Syndrom und Akrozyanose mit einer Minderdurchblutung vor allem von Fingern, Nase, Ohren oder Kinn.
Bei milden Verläufen verschwinden die Symptome in der Wärme, bei schwereren Fällen benötigen die Patienten Bluttransfusionen zur Behandlung der Anämie. Off Label werden Biologika (Rituximab, Eculizumab, Bortezomib) und Chemotherapeutika (Bendamustin, Fludarabin) mit unterschiedlichem Erfolg eingesetzt. Neue Hoffnung verspricht der kürzlich zugelassene Arzneistoff Sutimlimab. Der humanisierte monoklonale Antikörper blockiert selektiv den Signalweg des Immunsystems, der zur Hämolyse führt. Laut Studien kann Sutimlimab die hämolytische Anämie lindern.