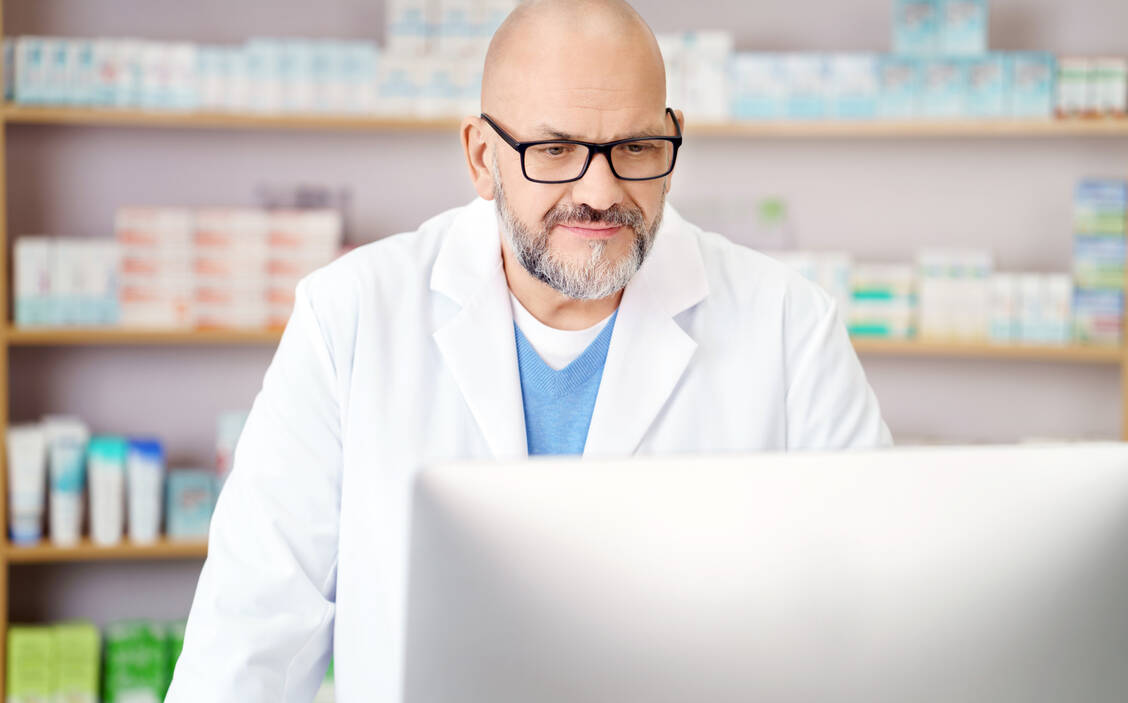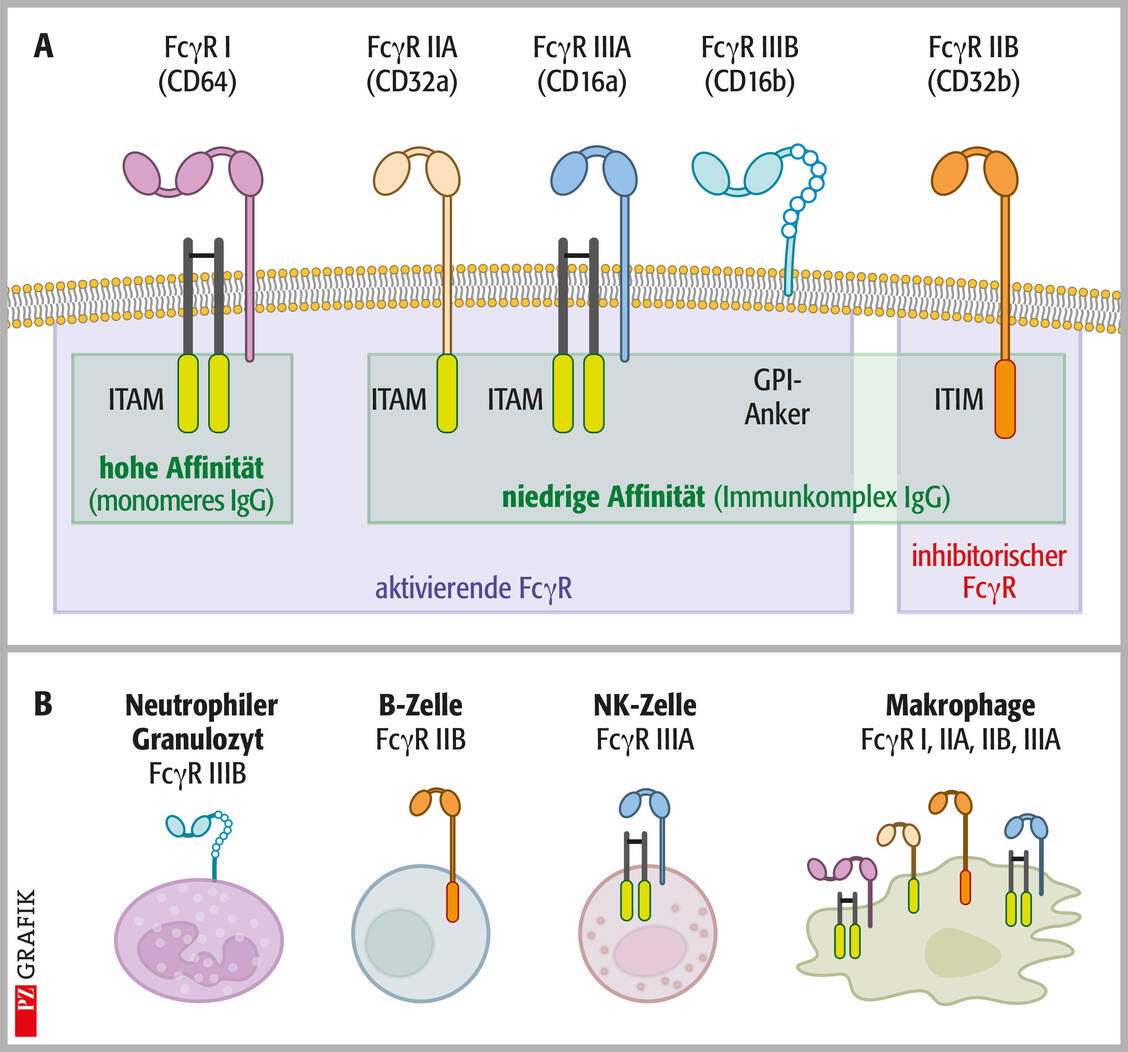Bei den Fraktionierungs-, Reinigungs- und Konzentrationsschritten werden physikalische und chemische Parameter wie Temperatur, pH-Wert, Ethanolkonzentration und Salzgehalt mehrfach variiert und dabei die Immunglobuline in Fraktion II angereichert. Gerinnungsfaktoren und Albumin werden in anderen Fraktionen gefällt (2). Mittels Octansäure und Lagerung bei niedrigem pH-Wert werden Plasmafette abgetrennt, die Fraktionen mittels Chromatografie getrennt und unerwünschte IgA- und IgM-Antikörper entfernt (2, 4). Partikel, Bakterien und Pilze werden mithilfe von Steril- und Nanofiltern entfernt. Zur Inaktivierung und Entfernung von umhüllten und nicht umhüllten Viren sind mindestens zwei unabhängige Schritte vorgeschrieben, sei es mittels Solvens-Detergens-Behandlung (S/D), Trockenhitze/Dampf, Caprylsäure-Behandlung, Ionenaustauschchromatografie (IEC), niedrigem pH (etwa pH 4) oder Nanofiltration (20 bis 35 nm) (4).