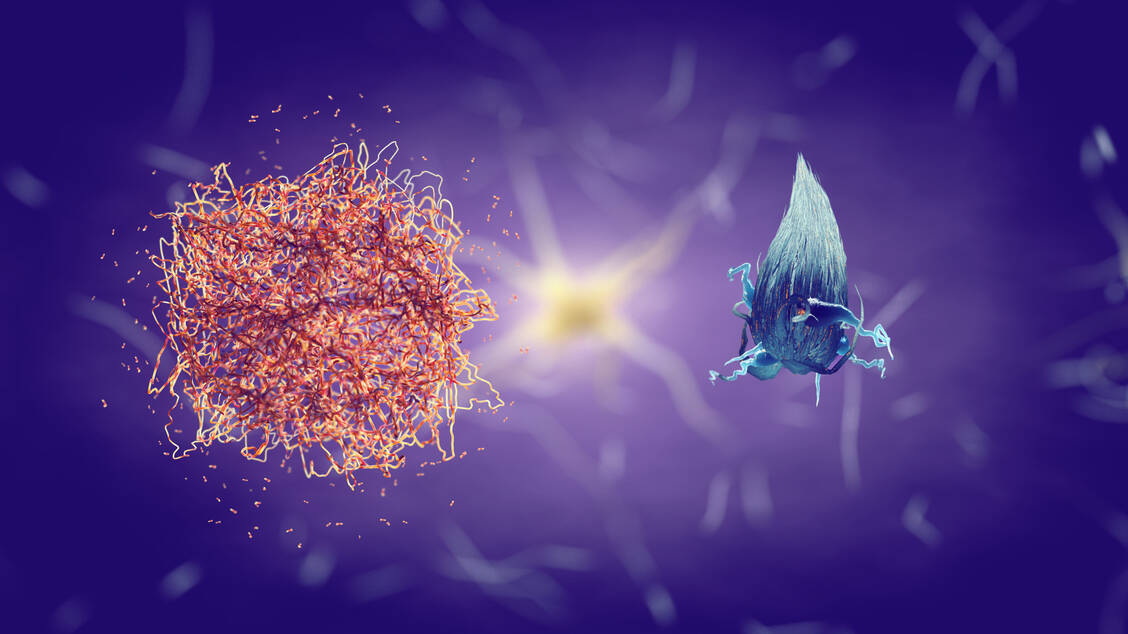Die Wissenschaftler schlussfolgern, dass die Effizienz der Übertragung von Keimstrukturen aus extrazellulären Vesikeln mit dem Vorhandensein spezifischer Liganden auf der Oberfläche der Partikel, die eine Wirtsrezeptor-Interaktion und/oder Fusion der Partikel mit der Zelle ermöglichen, korreliert. Das ist in hohem Maße plausibel. Denn Viren nutzen ihre Glykoproteine auf der Partikeloberfläche, um einen Membrankontakt und die Fusion des viralen Partikels mit der zu infizierenden Zelle zu ermöglichen. Der Kontakt mit den Rezeptoren führt zu Konformationsänderungen in den viralen Glykoproteinen, wodurch sich die beiden Membranen einander annähern und die Fusion der Lipidstrukturen erzwungen wird. Diese Eigenschaften der viralen Glykoproteine werden in der Forschung routinemäßig genutzt, um gentechnisch veränderte virale Vektoren zu pseudotypisieren.