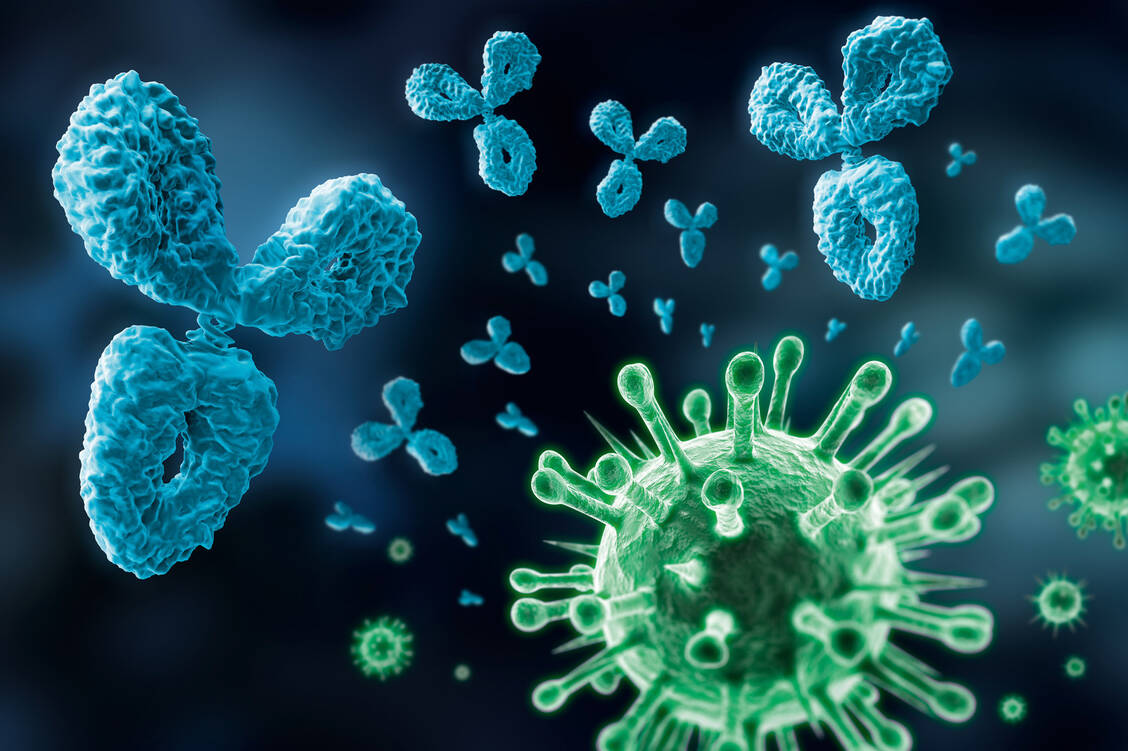In einem Bericht wurde unter zwei ansonsten gesunden Personen, die sich von einer Covid-19-Erkrankung erholt hatten und bei denen zwei oder mehr sequenzielle RT-PCR-Test im Abstand von mindestens 24 Stunden negativ ausgefallen waren, SARS-CoV-2-RNA in Rachenabstrichen bis zu zehn Tage lang sporadisch erneut nachgewiesen. In anderen Publikationen werden ähnliche Kasuistiken berichtet.
Demgegenüber gibt es derzeit keinen Beweis dafür, dass Personen nach einer klinischen Genesung das SARS-CoV-2 Virus auf andere übertragen hätten. Allerdings kann man eine solche Übertragungsmöglichkeit auch noch nicht ausschließen, insbesondere nicht bei Personen, die zum Beispiel aufgrund einer Immunschwäche für eine längere Ausscheidung anderer Krankheitserreger prädisponiert sein könnte