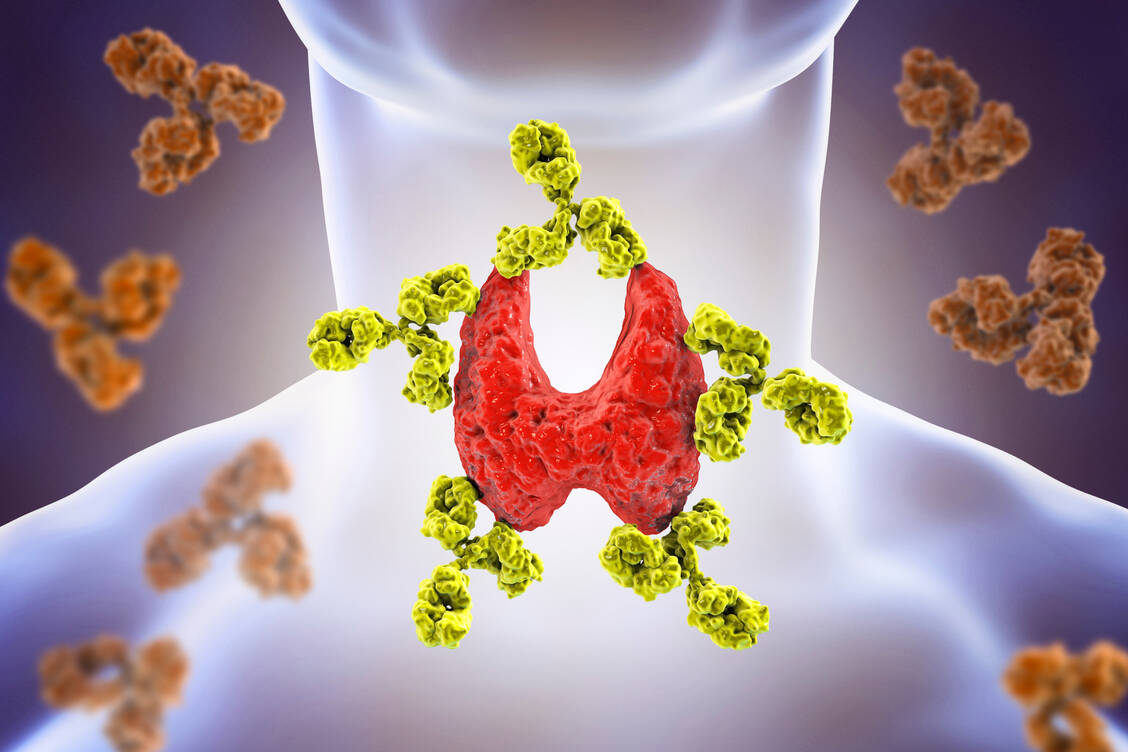Während Thiamazol und PTU beide zu etwa 100 Prozent bioverfügbar sind, unterscheiden sie sich deutlich in ihrer Halbwertszeit (HWZ). Diese beträgt bei Thiamazol sechs bis acht Stunden, trotzdem hält die Wirkung des Arzneistoffs für etwa 24 Stunden an. Mit einer HWZ von circa 90 Minuten und einer Wirkdauer von acht bis zwölf Stunden wird PTU deutlich schneller eliminiert und ist erheblich kürzer wirksam. Unter einer Thiamazol-Therapie normalisierten sich die T3/T4-Werte nach sechs Wochen, unter einer PTU-Behandlung nach etwa zwölf Wochen, erklärte der Referent. PTU biete jedoch auch Vorteile. Beispielsweise sei dieser Arzneistoff bevorzugt einzusetzen, wenn M. Basedow-Patienten zusätzlich an einer Leberinsuffizienz leiden, da Thiamazol zu einer kumulativen Toxizität in der kranken Leber führt.