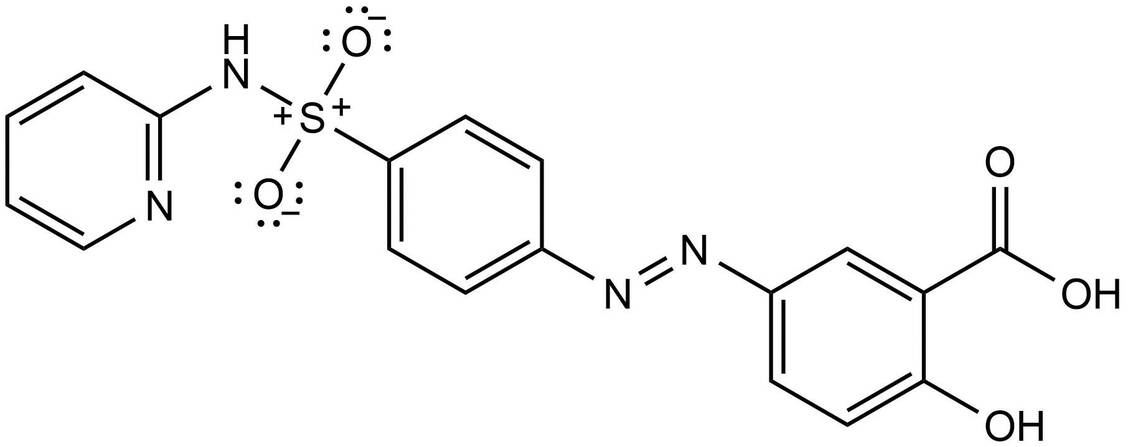Sulfasalazin-Tabletten werden mindestens eine Stunde vor einer Mahlzeit mit reichlich Flüssigkeit geschluckt.
Um Nebenwirkungen zu vermeiden, wird Sulfasalazin einschleichend dosiert. Erwachsene mit einer rheumatologischen Erkrankung nehmen in Woche 1 abends 500 mg, in Woche 2 morgens und abends je 500 mg, in Woche 3 morgens 500 mg und abends 1 g sowie ab Woche 4 morgens und abends je 1 g. Bei Bedarf kann die Dosis nach drei Monaten auf dreimal täglich 1 g gesteigert werden. Die maximale Tagesdosis beträgt 4 g. Ältere Patienten sollten nicht mehr als 1,5 g Sulfasalazin täglich erhalten.
Bei Erwachsenen mit CED wird Sulfasalazin zur Rezidivprophylaxe mit 2 bis 3 g täglich verteilt auf zwei Einzeldosen dosiert, im aktiven Schub mit 3 bis 4 g verteilt auf drei Einzeldosen.
Kinder ab zwei Jahren mit CED erhalten initial 40 bis 60 mg Sulfasalazin pro kg Körpergewicht täglich und als Erhaltungsdosis 30 bis 40 mg/kg KG/d, jeweils verteilt auf drei bis vier Einzeldosen. Bei Kindern mit juveniler idiopathischer Arthritis ist die Anwendung ab sechs Jahren erlaubt. Hier beträgt die empfohlene Dosis 50 mg/kg KG/d (maximal 2 g) verteilt auf zwei Einzeldosen, die nach drei Monaten auf 75 mg/kg KG/d (maximal 3 g) gesteigert werden kann.