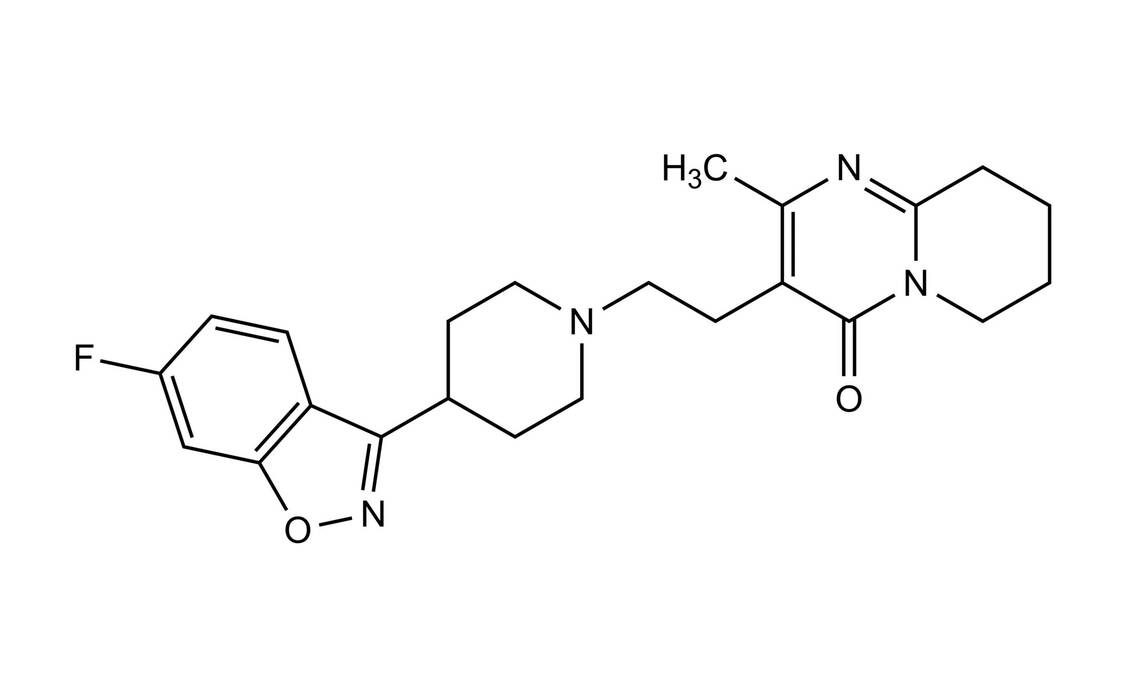Die Dosierung hängt von der Indikation ab. Übliche Dosen sind bei Schizophrenie 4 bis 6 mg Risperidon täglich, entweder als Einzeldosis oder aufgeteilt auf zwei Dosen; bei Manie im Rahmen bipolarer Störungen können flexible Dosen über einen Bereich von 1 bis 6 mg pro Tag verabreicht werden. Ältere Patienten mit diesen Indikationen sollten niedrigere Dosen erhalten. Bei Demenzpatienten mit Aggression beträgt die optimale Erhaltungsdosis für die Mehrzahl der Patienten zweimal täglich 0,5 mg, es sind aber auch bis zu zweimal täglich 1 mg möglich. Für pädiatrische Patienten mit Aggression liegt die optimale Dosis für die meisten Kinder unter 50 kg Körpergewicht bei einmal täglich 0,5 mg, bei schwereren Kindern bei einmal täglich 1 mg.
Abweichungen von diesen Richtwerten nach unten und nach oben sind möglich, wobei höhere Dosen das Risiko für extrapyramidale Nebenwirkungen erhöhen. Grundsätzlich wird auftitriert – bei Patienten mit beeiträchtigter Nieren- oder Leberfunktion besonders vorsichtig – und beim Absetzen ausgeschlichen. Risperidon steht oral als Filmtabletten in Wirkstärken von 0,5 bis 4 mg sowie als Lösung zum Einnehmen zur Verfügung. Zudem gibt es Depotformen (unter anderem Risperdal® consta, Okedi®) für Schizophreniepatienten, die je nach Präparat alle zwei bis vier Wochen intramuskulär injiziert werden. Da die Resorption von Risperidon nicht durch Nahrung beeinflusst wird, können die oralen Darreichungsformen unabhängig von den Mahlzeiten eingenommen werden.