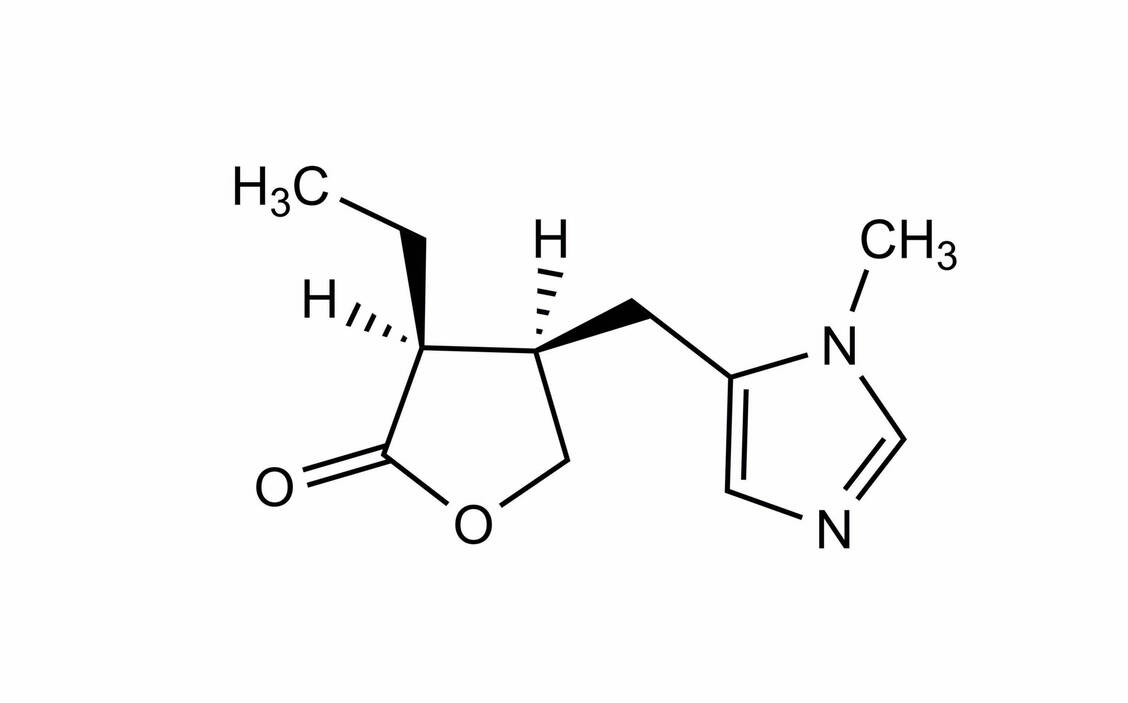Laut der Fachinformation von Salagen kann die gleichzeitige Einnahme von β-adrenergen Antagonisten zu Reizleitungsstörungen am Herzen führen. Bei gleichzeitiger Einnahme von Arzneimitteln mit parasympathomimetischer Wirkung ist wenig überraschend mit additiven Effekten zu rechnen. Zudem kann es unter Pilocarpin zur Antagonisierung der anticholinergen Wirkung anderer gleichzeitig angewendeter Arzneimittel kommen, zum Beispiel von inhaliertem Ipratropiumbromid.
Wenn auch nicht klinisch belegt, kann die miotische Wirkung von Pilocarpin antagonisiert werden durch langfristige Therapien mit topisch oder systemisch verabreichten Corticoiden, Anticholinergika, Antihistaminika, Pethidin, Sympathomimetika oder trizyklischen Antidepressiva. Zudem kann Pilocarpin auch nach lokaler Applikation am Auge die Wirkung depolarisierender Muskelrelaxanzien verlängern. Die Wirkung stabilisierender Muskelrelaxanzien kann dagegen vermindert werden.