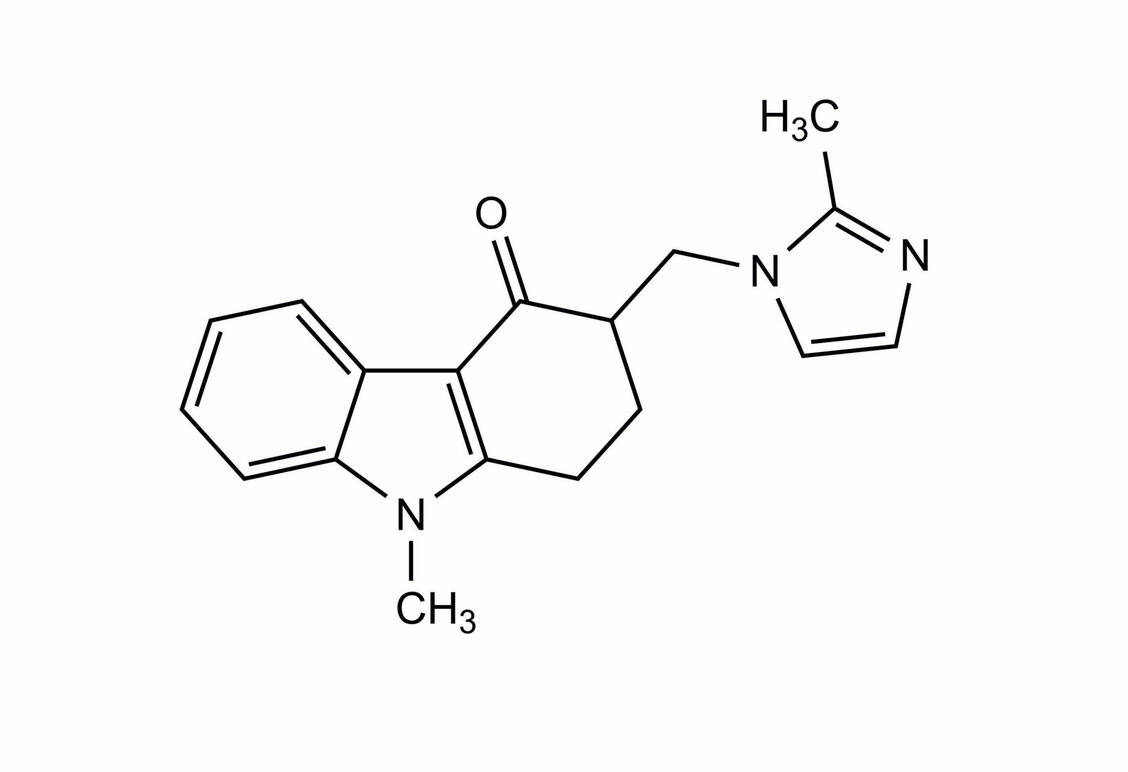Die Dosierung von Ondansetron bei einer Chemo- oder Strahlentherapie richtet sich nach ihrem emetogenen Potenzial. Bei Erwachsenen beträgt die empfohlene Dosis bei peroraler Gabe 8 mg, eingenommen ein bis zwei Stunden vor der Chemotherapie oder Bestrahlung, gefolgt von 8 mg alle zwölf Stunden über maximal fünf Tage. Bei hoch emetogener Chemotherapie kann eine orale Einzeldosis bis maximal 24 mg Ondansetron zusammen mit Dexamethason gegeben werden. Nach 24 Stunden kann die Behandlung mit 8 mg Ondansetron zweimal täglich bis zu fünf Tage nach einem Behandlungszyklus fortgesetzt werden.
Intravenös oder -muskulär können Erwachsene 8 mg Ondansetron unmittelbar vor einer Chemo- oder Strahlentherapie erhalten. Bei hoch emetogener Chemotherapie können anschließend im Abstand von je vier Stunden zwei weitere 8-mg-Dosen verabreicht werden oder 1 mg Ondansetron pro Stunde über bis zu 24 Stunden kontinuierlich infundiert werden. Höhere Einzeldosen bis maximal 16 mg dürfen nur verdünnt infundiert werden. Die Wirksamkeit kann auch hier durch Kombination mit Dexamethason verstärkt werden.
Zur Prophylaxe von Übelkeit und Erbrechen nach Operationen beträgt die empfohlene perorale Dosis bei Erwachsenen 16 mg Ondansetron eine Stunde vor der Narkose. Alternativ können 4 mg bei Narkoseeinleitung intramuskulär oder intravenös verabreicht werden. Bei manifestem postoperativen Erbrechen wird eine Einzeldosis von 4 mg intravenös oder intramuskulär empfohlen.
Bei Säuglingen, Kindern und Jugendlichen wird die Dosierung auf Grundlage der Körperoberfläche oder des Körpergewichts ermittelt.