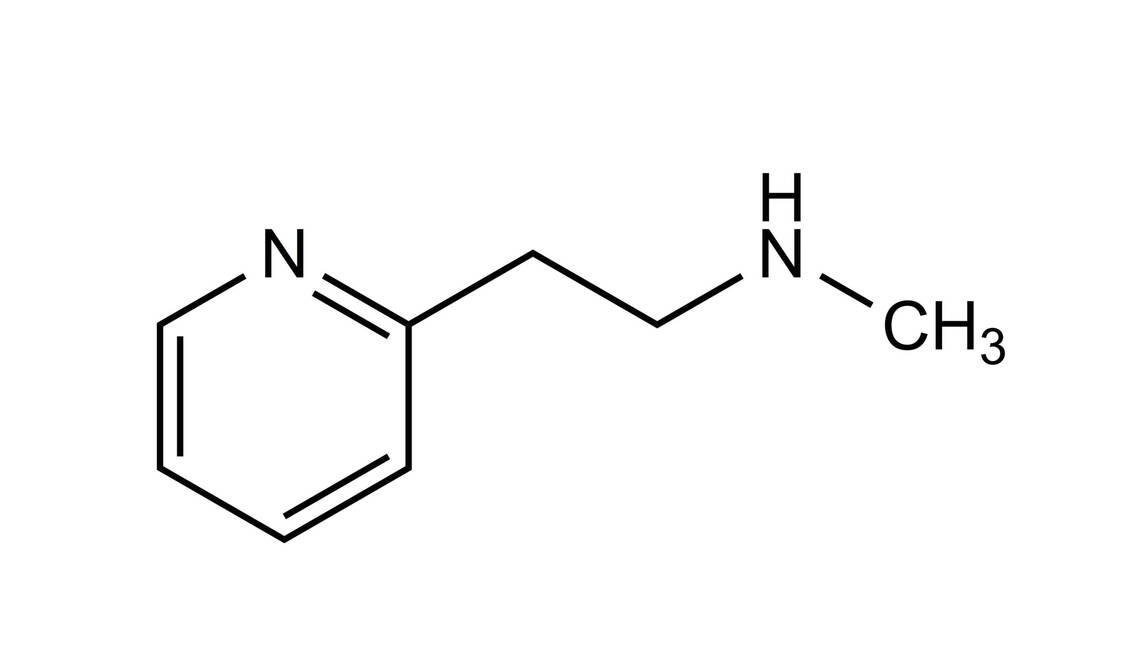»Bei der Einnahme von Betahistin in Kombination mit anderen Arzneimitteln ist aufgrund fehlender Interaktionsdaten Vorsicht geboten«, heißt es in der Fachinformation entsprechender Präparate. Basierend auf In-vitro-Daten seien keine CYP-Interaktionen zu erwarten. Jedoch ist die Wechselwirkung von Betahistin mit unselektiven Hemmstoffen der Monoaminoxidase (MAO), beispielsweise Tranylcypromin, und mit selektiven MAO-B-Hemmern wie Selegilin und Rasagilin, zu beachten. Sie stören den Abbau von Betahistin, weshalb bei gleichzeitiger Anwendung Vorsicht geboten ist.
Als partieller H1-Rezeptoragonist kann Betahistin zudem die Wirkung von Antihistaminika abschwächen – und umgekehrt. Daher sollten beide nicht gleichzeitig eingenommen werden. Soll eine Therapie mit Betahistin auf eine Therapie mit einem Antihistaminikum folgen, empfiehlt es sich, das Antihistaminikum zunächst über etwa sechs Tage auszuschleichen. Andernfalls kann es zu Entzugserscheinungen wie Unruhe und Schlafstörungen kommen, da die meisten Antihistaminika eine leicht sedierende Wirkung haben, die dann abrupt wegfallen würde.
Ob Betahistin mit anderen Arzneimitteln interagiert, die ebenfalls bei Morbus Menière zum Einsatz kommen können, wurde nicht untersucht. Dazu zählen etwa Vasodilatanzien, Psychopharmaka wie Sedativa, Tranquilizer und Neuroleptika sowie Parasympatholytika und Vitamine.