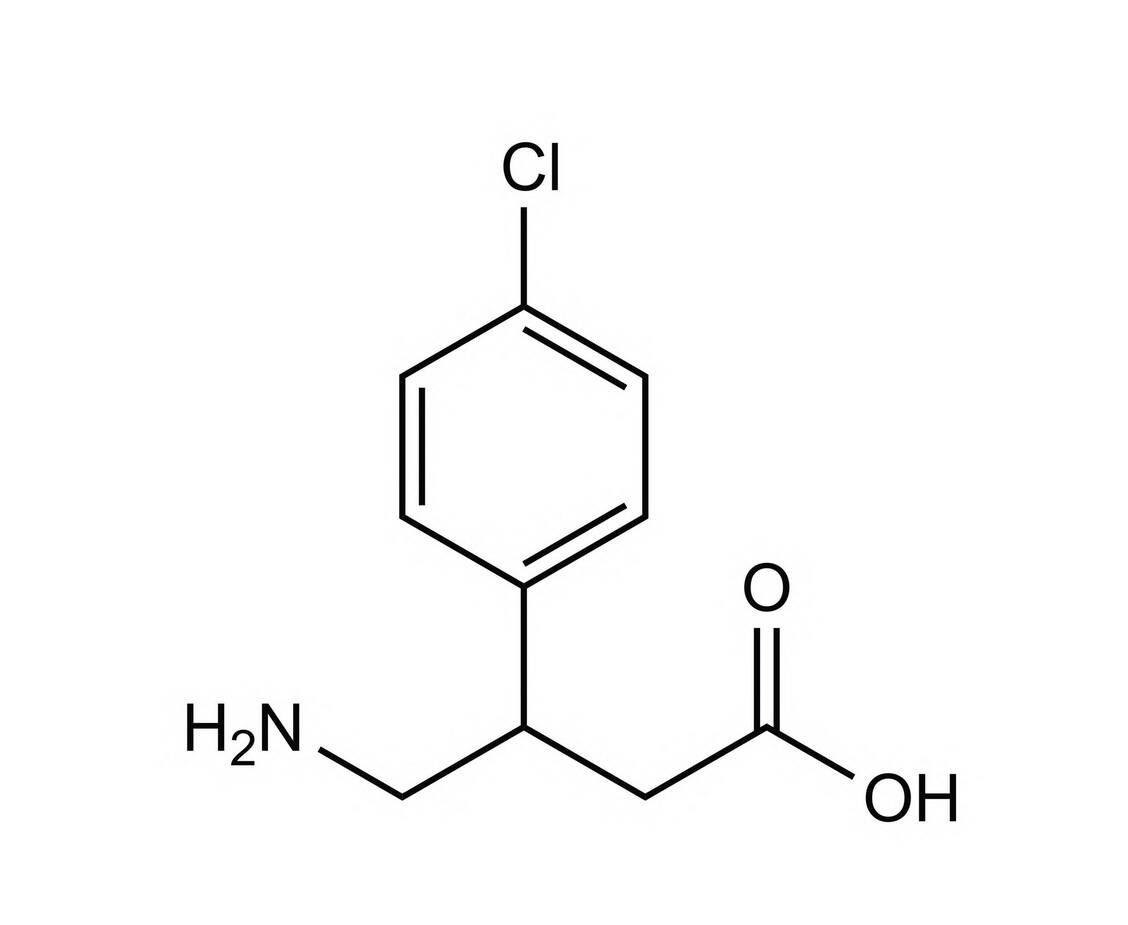Eine einschleichende Therapie hilft, Nebenwirkungen möglichst gering zu halten. Bei Erwachsenen beginnt man mit 15 mg Baclofen täglich peroral, verteilt auf zwei bis vier Einzeldosen, und steigert langsam um 5 bis 15 mg bis zur optimalen Tagesdosis. Diese liegt meist bei 30 bis 75 mg (Tageshöchstdosis) und wird auf zwei bis vier Einzelgaben verteilt. Bei älteren Menschen, bei zerebraler Spastizität oder eingeschränkter Nierenfunktion geht man langsamer und vorsichtiger vor.
Dies gilt auch für Kinder und Jugendliche. Hier beginnt man mit einer sehr geringen Dosierung (ungefähr 0,3 mg/kg pro Tag), meist verteilt auf vier Einzeldosen. Die maximale Tagesdosis liegt für Kinder unter acht Jahren bei 40 mg, bei älteren Kindern bei 60 mg.
Die Tabletten sollen zu den Mahlzeiten mit etwas Flüssigkeit oder mit Milch eingenommen werden.