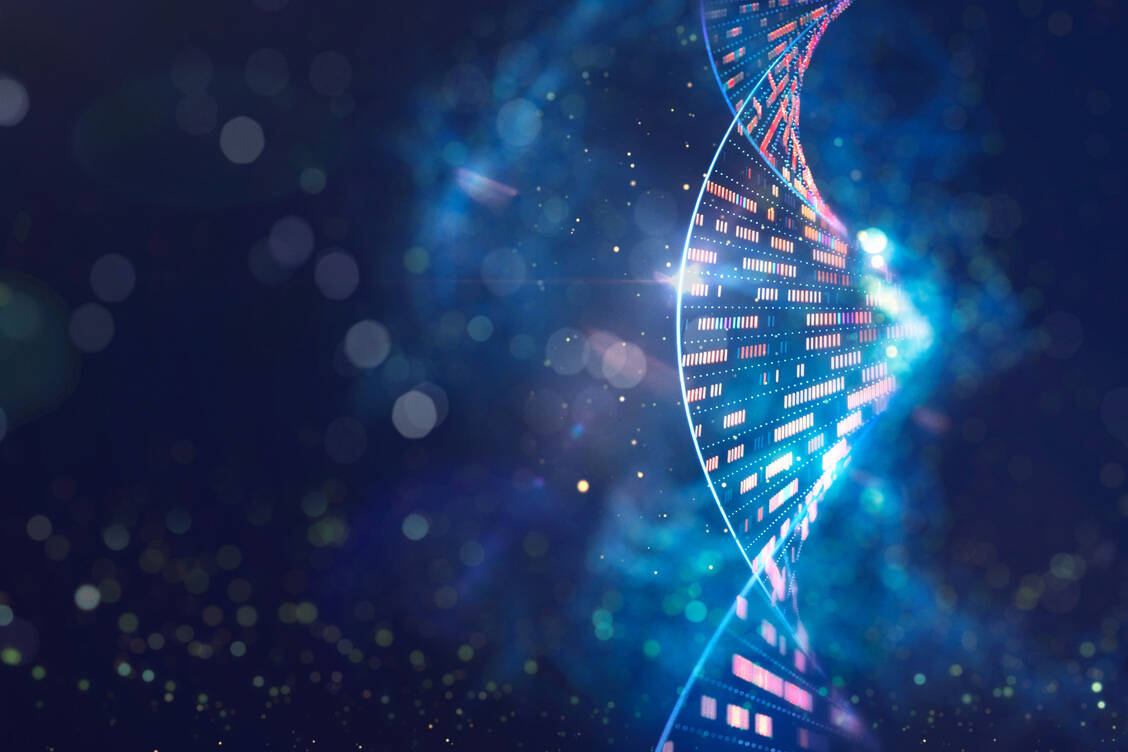Die einfachste Form eines Transposons ist ein sogenanntes Insertionselement (IS-Element). Es besteht im Prinzip aus zwei Begrenzungssequenzen und dem dazwischenliegenden Gen für eine Rekombinase. Dieses Enzym katalysiert das Ausschneiden und Einfügen des springenden Elements an einem neuen Genomort, es kann also die DNA-Stränge schneiden und wieder verbinden. Zwei Gruppen von IS-Elementen, IS110 und IS1111, haben sich die Forschenden genauer angeschaut. Dabei entdeckten sie, dass diese IS-Elemente zusätzlich zum Rekombinase-Gen noch eine nicht codierende Region aufweisen, von der eine sogenannte bridge RNA (bRNA) oder seeker RNA (seekRNA) abgelesen wird, über die die Insertionsposition festgelegt wird.