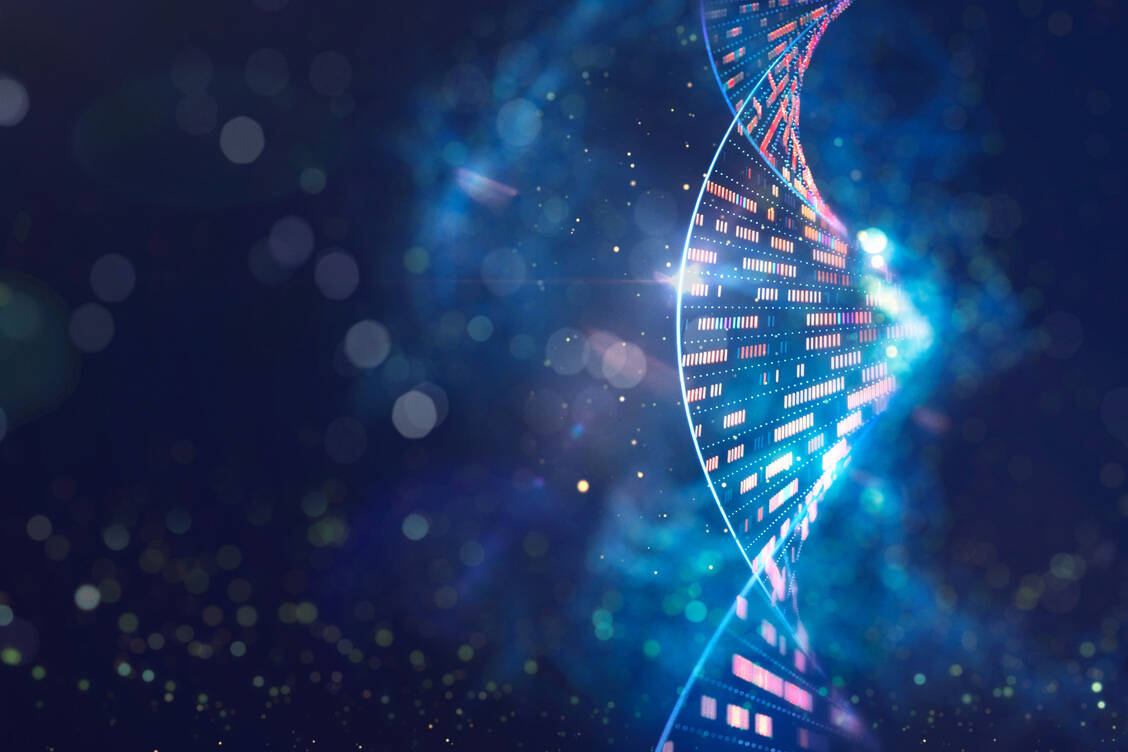So betont beispielsweise Professor Dr. Holger Puchta, Inhaber des Lehrstuhls Molekularbiologie und Biochemie der Pflanzen am Karlsruher Institut für Technologie, dass es sich hier um Grundlagenforschung handele. Das Neue an den Arbeiten sei die Entdeckung der bRNA und die Aufklärung des Mechanismus, nach dem diese RNA das DNA-Element zum Targetlokus lenkt. »Da man die bRNA nach Belieben sowohl in den Bereichen für die Target- als auch für die Insert-Erkennung verändern kann, hat man so ein neues programmierbares Werkzeug geschaffen, jede beliebige DNA an jede beliebige Stelle ins Genom zu integrieren«, sagt er. »Das Ganze hat ein herausragendes Potenzial, ist aber momentan noch relativ weit von einer praktischen Anwendung in Medizin oder Pflanzenzüchtung entfernt.«