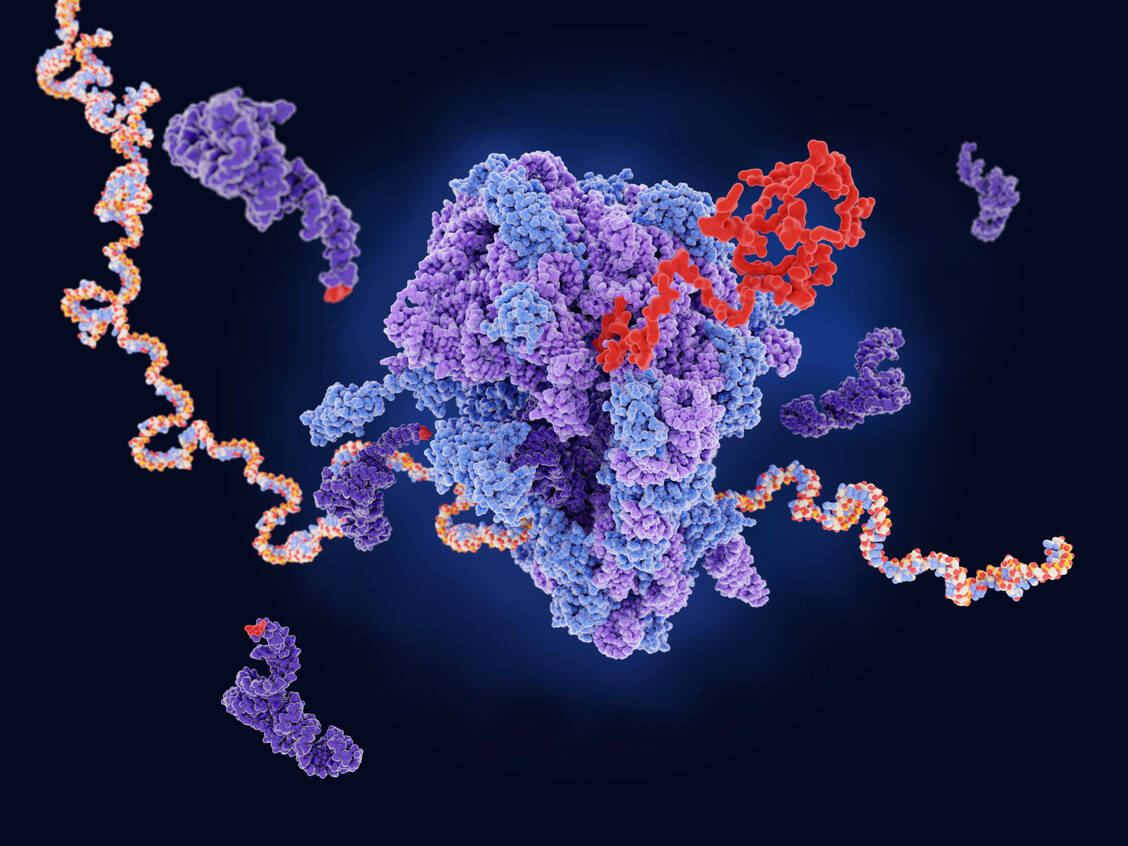Auf den ersten Blick erscheinen diese Daten beunruhigend, zumal gezeigt werden konnte, dass die falsch übersetzten Proteine auch bei Geimpften nachweisbar und immunaktiv sind. Allerdings sehen Experten, die vom Science Media Center Germany befragt wurden, die neuen Erkenntnisse nicht als kritisch an. So weist Professor Dr. Marina Rodnina, Direktorin der Abteilung Physikalische Biochemie am Max-Planck-Institut für Multidisziplinäre Naturwissenschaften (MPI-NAT) in Göttingen, darauf hin, dass ähnliche Proteinartefakte in der Zelle auch ohne Impfung vorkommen können und die Zelle gut gerüstet ist, sie zu entfernen. Zudem seien die entstandene Mengen offenbar sehr gering. »Die Autoren haben diese +1 Peptide sehr gezielt bestimmt, gesucht und gefunden. Aber was die Zelle sonst so auf natürlichem Wege macht, haben sie nicht verglichen.«