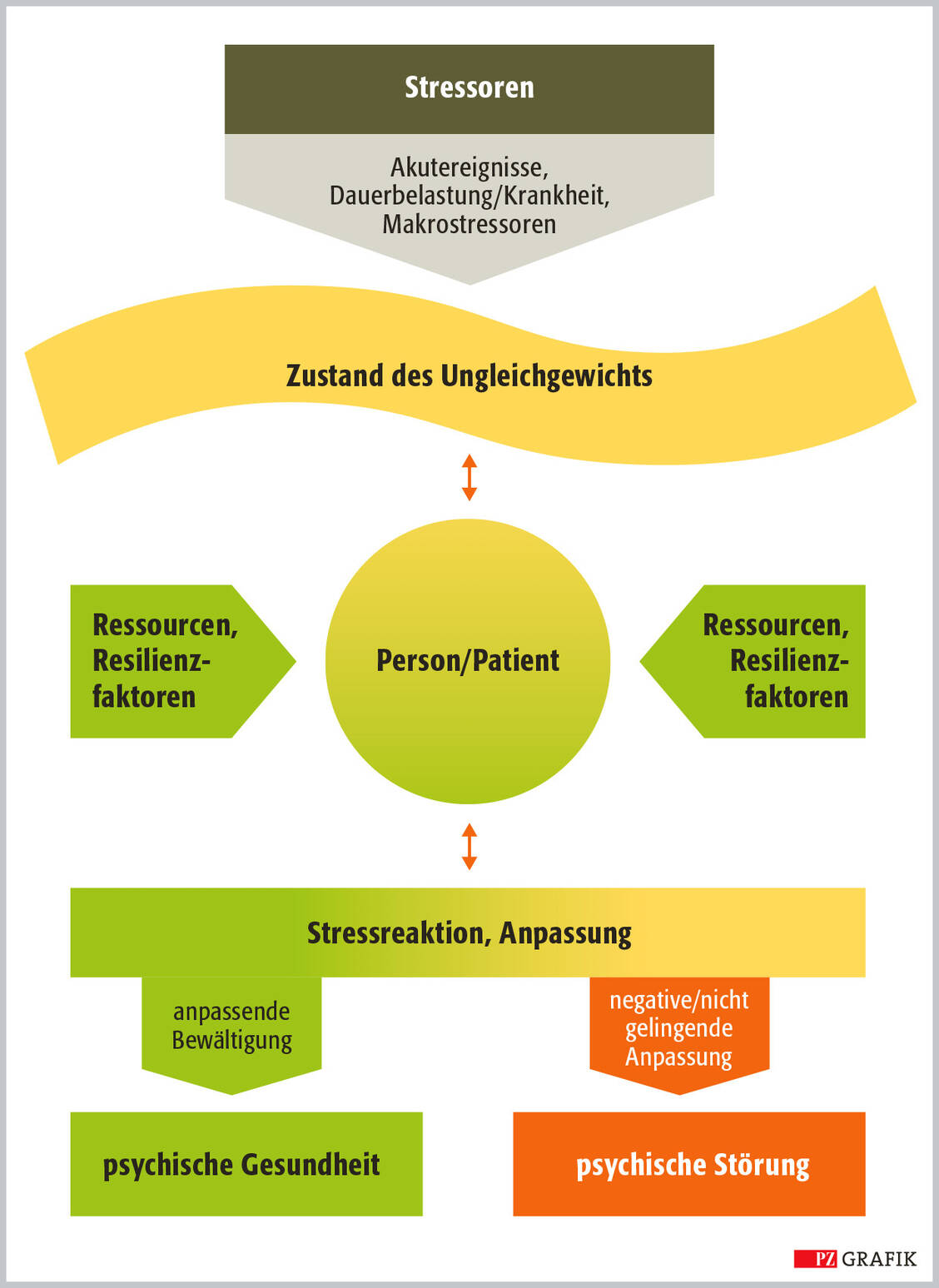SSRI sind meist die Mittel der ersten Wahl für depressive Menschen. Bei Diabetespatienten ist einiges zu beachten.
Fluoxetin, Sertralin: Die Insulinsensitivität wird erhöht. Der Blutzucker ist häufiger zu kontrollieren und gegebenenfalls die Insulindosierung zu reduzieren. Insbesondere bei Daueranwendung von SSRI gibt es gehäuft Hypoglykämien.
Duloxetin wird auch als Komedikation bei neuropathischen Schmerzen verwendet und führt eher zu Hyperglykämien, auf die der Patient mit einer etwas höheren Gabe von Insulin reagieren muss.
Citalopram und Escitalopram können die QT-Zeit des Herzens verlängern und damit das kardiale Risiko erhöhen. Daher sollte (Es-)Citalopram nur mit äußerster Vorsicht bei Menschen mit Diabetes und Herzerkrankungen angewendet werden.
Trizyklische Antidepressiva: Nortriptylin erhöht den Blutzuckerspiegel. Mirtazapin und Mianserin führen zu einer Gewichtszunahme, was einen weiteren Risikofaktor für kardiale Folgeerkrankungen darstellt.