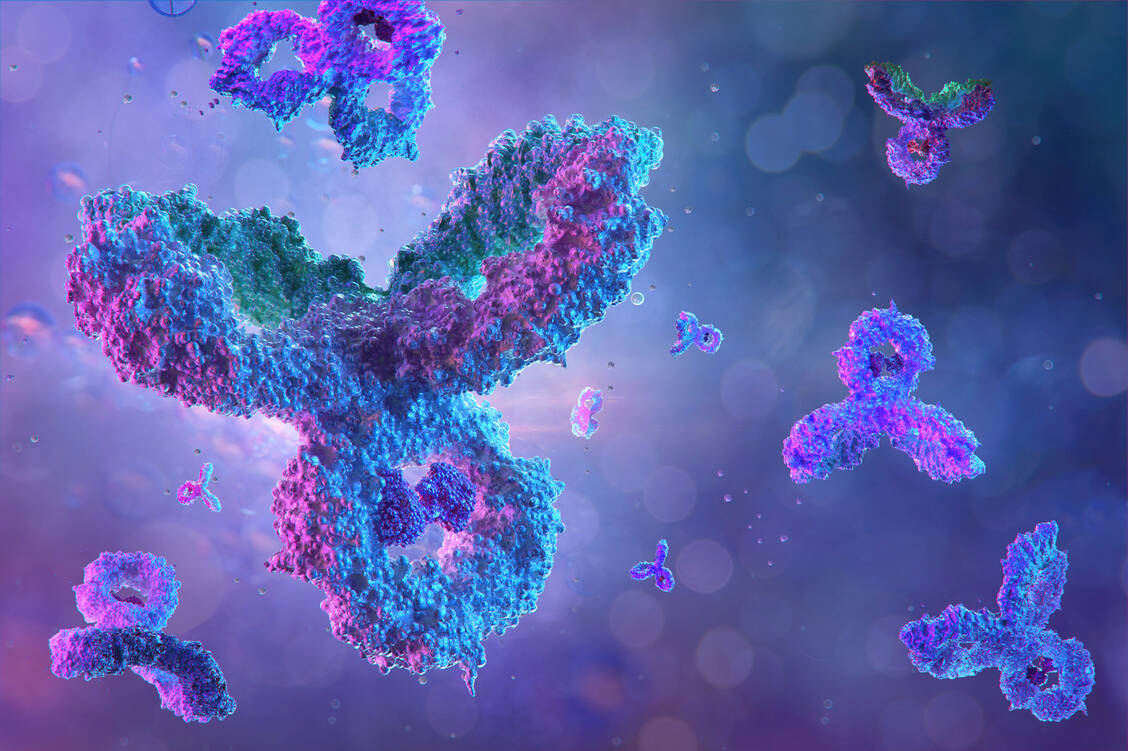Mittlerweile gibt es überzeugende Beweise dafür, dass nicht neutralisierende Fc-Effektor-Funktionen auch im Fall von SARS-CoV-2 wichtig sind. So vermitteln mehrere monoklonale Antikörper (mAb) in humanisierten Mausmodellen von SARS-CoV-2 basierend auf einer antikörperabhängigen zellulären Phagozytose (ADCP) und einer ADCC einen Schutz, ohne den Schweregrad der Erkrankung zu verschlechtern. Das deutet darauf hin, dass sie auf evolutionär stabile Epitope abzielen und die Immunantwort verstärken können. Fc-Engineering-Techniken haben zudem diese Schutzwirkung weiter verbessert, indem die mAb so modifiziert wurden, dass sie stärkere Immunreaktionen auslösen, ohne eine schädliche Entzündung zu verursachen.