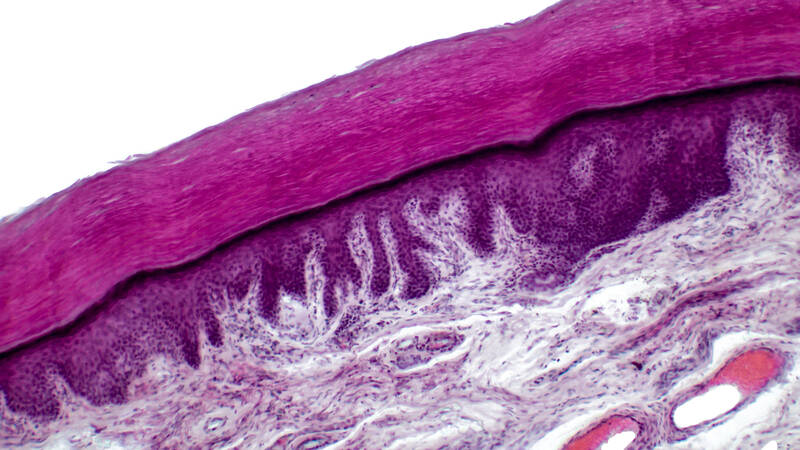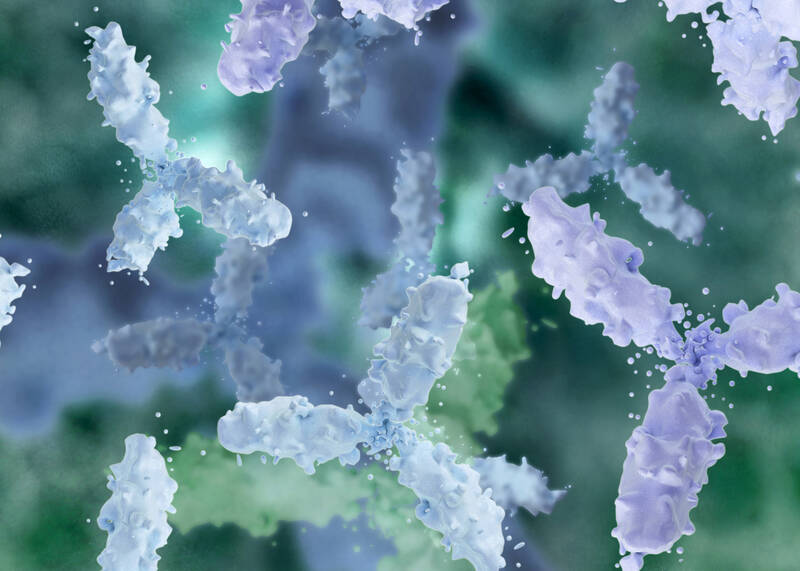Prävalenz
Etwa 7 Prozent der Kinder und bis zu 2 Prozent der Erwachsenen in Deutschland, weltweit häufiger in industrialisierten Ländern
Ätiologie
Multifaktoriell: genetische Prädisposition, zum Beispiel Filaggrin-Mutationen, Dysfunktion der Hautbarriere, immunologische Überreaktion, Umweltfaktoren (Allergene, Schadstoffe), Stress
Pathophysiologie
Defekte der Hautbarriere führen zu erhöhter Permeabilität, Feuchtigkeitsverlust und erhöhter Exposition gegenüber Umweltallergenen; Dysregulation des Immunsystems mit TH2/TH22-Dominanz
Leitsymptome
Chronisch-rezidivierende Ekzeme, intensiver Juckreiz, trockene und empfindliche Haut, oft beginnend im frühen Kindesalter; typische Verteilung der Läsionen je nach Alter
Klinische Manifestation
Akute Schübe mit erythematösen, exsudativen Läsionen, chronische Phasen mit Lichenifikation, Hyperkeratose; oft quälender Juckreiz (Pruritus), kann Schlaf und Lebensqualität stark beeinträchtigen
Differenzialdiagnose
Psoriasis, seborrhoisches Ekzem, Kontaktdermatitis, Ichthyosen, Skabies, kutane Lymphome
Drei Therapiestufen
Basistherapie (Emollienzien zur Unterstützung der Hautbarriere); topische Therapie (Glucocorticoide, Calcineurin-Inhibitoren); systemische Therapie (Glucocorticoide, Biologika, Januskinase-Inhibitoren)
Proaktive Therapie
Langfristiger Einsatz topischer entzündungshemmender Mittel auf erkrankte Hautpartien, kombiniert mit Emollienzien zur Prävention von Rezidiven
Antimikrobielle Therapie
Bei Infektionen, zum Beispiel mit Staphylococcus aureus, aber keine Lokaltherapie aufgrund von Resistenzbildung; systemische Antibiotika nur bei großflächigen Infektionen
Prognose
Oft Rückbildung im Erwachsenenalter, bei vielen Patienten jedoch persistierende oder rezidivierende Symptome; Verschlechterung durch Stress, Klimafaktoren und Infektionen möglich
Komorbiditäten
Häufig mit anderen atopischen Erkrankungen assoziiert wie Asthma, allergische Rhinitis, Nahrungsmittelallergien; erhöhtes Risiko für psychische Störungen und Schlafstörungen