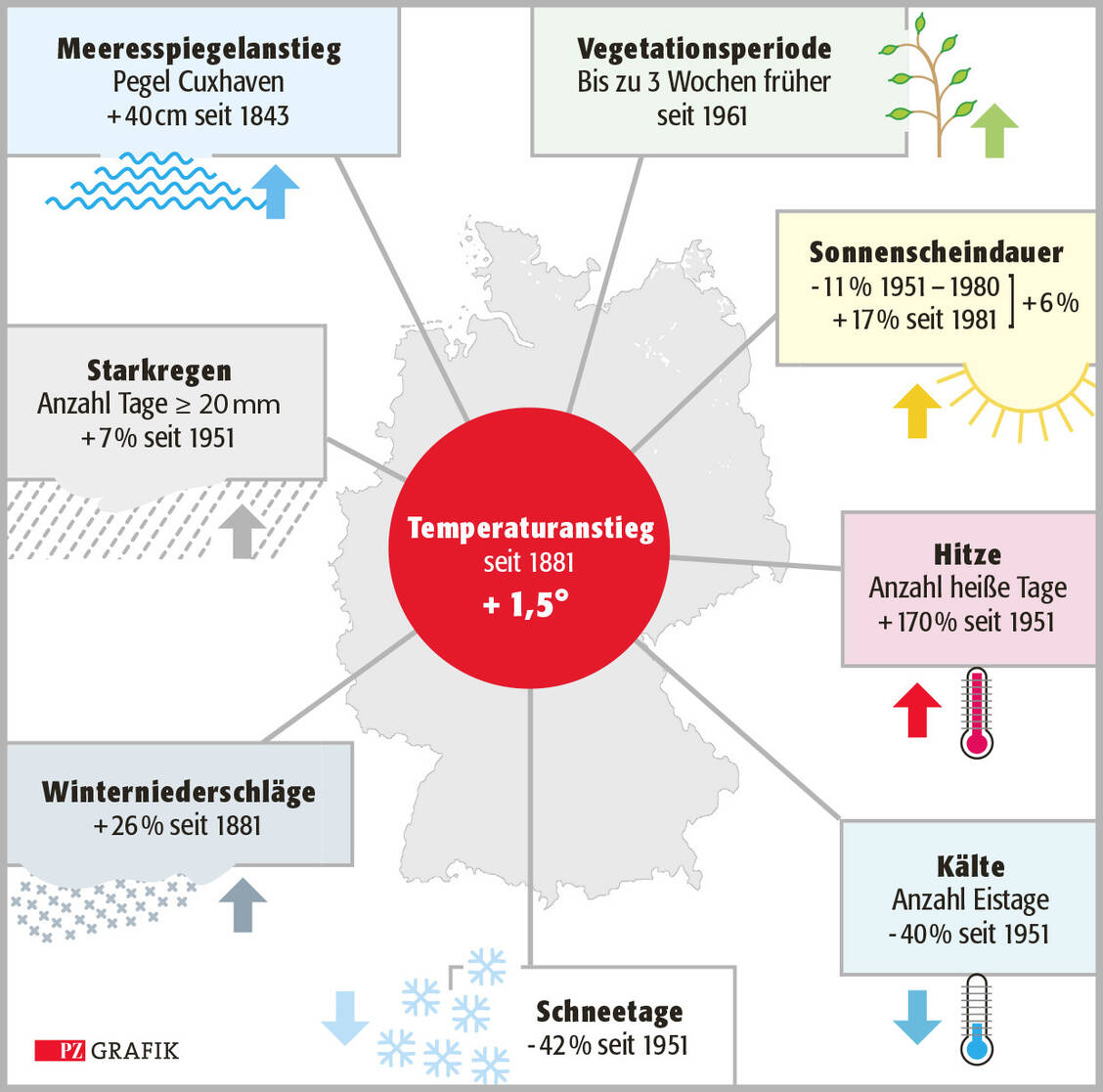Zudem sei bei kardiovaskulär wirkenden Arzneistoffen wie Betablockern, ACE-Hemmern, Sartanen, Diuretika, Calciumantagonisten, Clonidin oder Moxonidin Vorsicht geboten. Bei Hitze könne der blutdrucksenkende Effekt von Antihypertensiva verstärkt sein und dadurch Bewusstseinsverlust, Durchblutungsstörungen der Organe oder sogar Herzinfarkte hervorrufen. Antianginosa wie Nitrate oder Molsidomin, die eine Therapieoption für Patienten mit Angina pectoris sind, seien kritisch, da sie gefäßerweiternd wirken. »Diese Medikamente sollten bei gefährdeten Patienten in einer Hitzewelle vorrangig abgesetzt werden«, resümiert Kuch. Betablocker verhinderten im Gegensatz dazu, dass die peripheren Gefäße weitgestellt werden, was zu einer gestörten Hitzeableitung und einer erhöhten Schweißsekretionsschwelle führe.