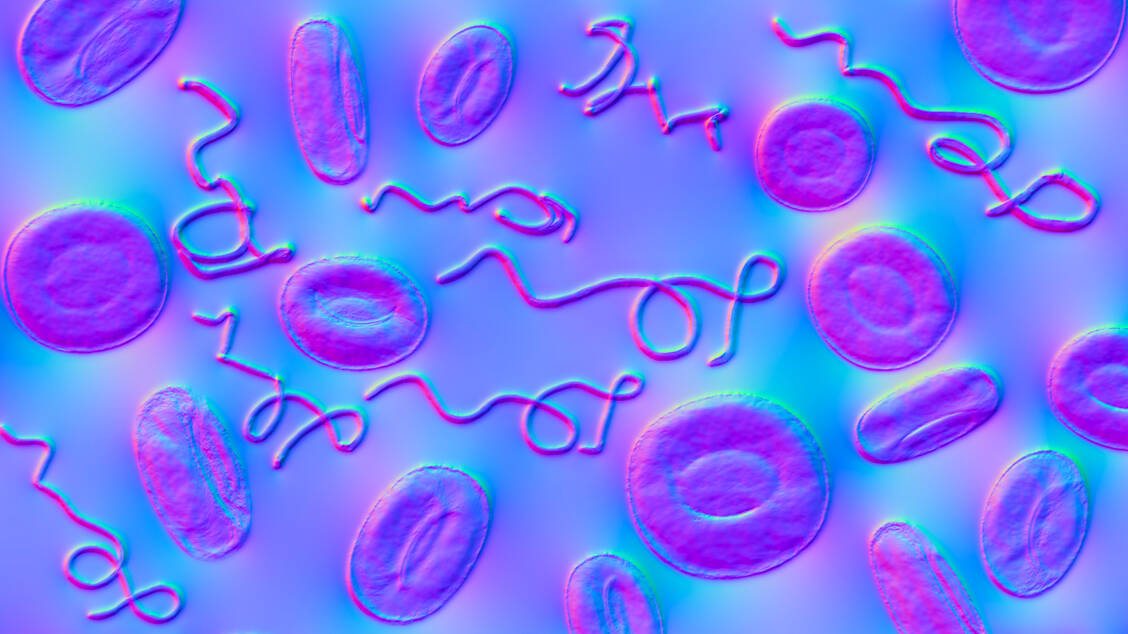Mithilfe eines Mausmodells wiesen die Forschenden nach, dass polymere Peptidoglykan-Fragmente nach systemischer Applikation in Leber und Milz der Tiere akkumulieren und dort über Wochen persistieren. Diese Persistenz ist chemisch bedingt, denn die Peptidoglykan-Fragmente von Borrelia burgdorferi (PGBb) besitzen besondere Strukturelemente wie L-Ornithin im Stammpeptid und das ungewöhnliche Glykan-Endmotiv G-G-anhM. Besonders diese Komponente scheint die verlängerte Verweildauer zu begünstigen. Denn Vergleichsstudien mit peptidoglykanischen Zellwänden anderer Bakterien, darunter Escherichia coli, Staphylococcus aureus oder Deinococcus radiodurans, zeigten eine deutlich schnellere Clearance, was auf die Einzigartigkeit von PGBb in Bezug auf seine Persistenz hindeutet.