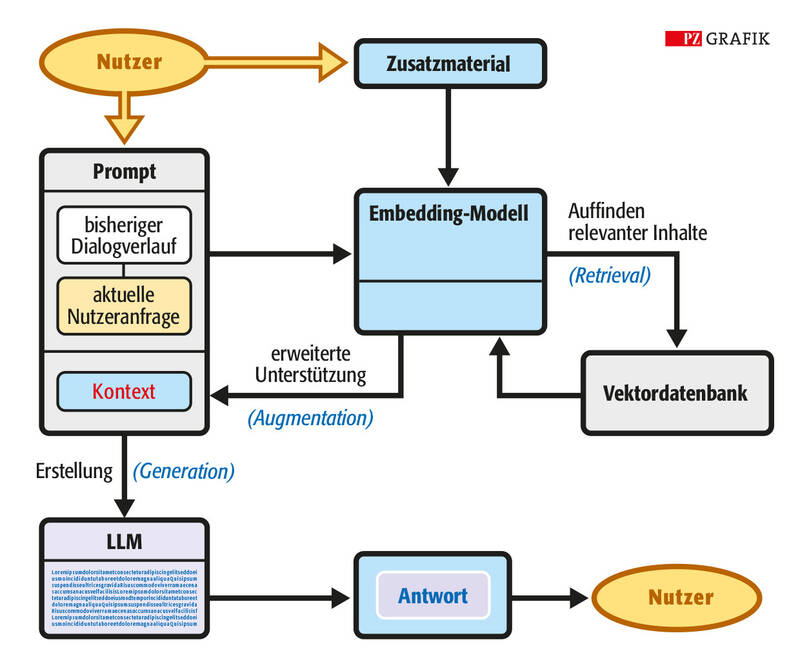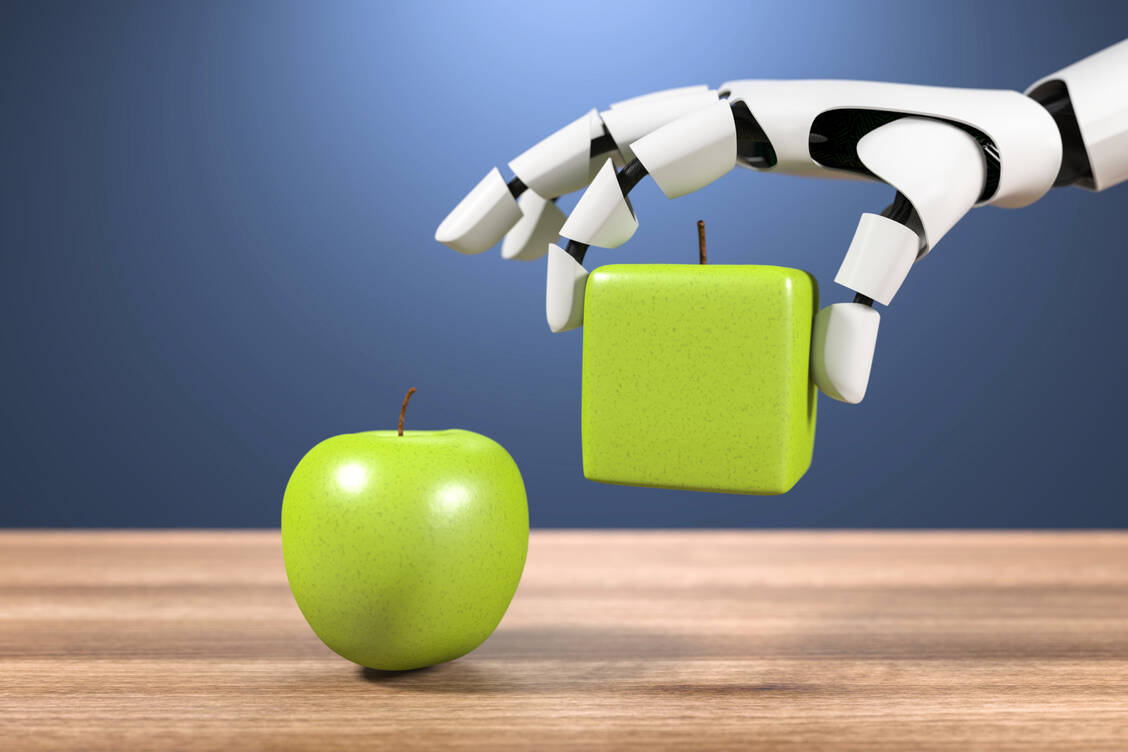Hier der Original-Output von ChatGPT 4o am 27. November 2024 mit den Prompts:
»Und jetzt habe ich noch eine lustige Aufgabe: Bitte schreibe einen kurzen Dialog zwischen einem Karnevalsjecken aus Düsseldorf und einer Apothekerin. Der Jeck spricht rheinischen Dialekt und hat nach dem Rosenmontagsumzug Katerbeschwerden. Die Apothekerin berät ihn, was er dagegen tun kann und welche Arzneimittel dazu infrage kommen.«
Und nach einer zu stark dialektgeprägten Version heißt der zweite Prompt:
»Das gefällt mir schon ganz gut. Da die Szene in Düsseldorf spielt, sagen die Akteure nur »Helau« und nie »Alaaf«. Und die Apothekerin spricht im wesentlichen Hochdeutsch, vielleicht mit ein paar rheinischen Ausdrücken. Kannst Du das bitte mit diesen Vorgaben noch einmal wiederholen?«
Der kleine Fehler im letzten Satz des Jecken wurde bewusst nicht korrigiert.
Wie sich KI das Beratungsgespräch vorstellt
Jeck: »Helau! Mensch, wat war dat für’n Umzug! Aba jetz haut mich der Kater weg. Mein Kopp hämmert wie en Trommelkorps! Wat kann isch do maache?«
Apothekerin: »Helau! Da haben se aber joot jefiert, wat? Keine Sorge, dat kriegen mer hin. Wichtig ist zuerst, dass Sie ganz viel Wasser trinken. Und ich hab auch noch paar Tipps für Sie.«
Jeck: »Jo, Wasser hab ich schon en paar Pittermännchen innen Kopp jeschütt, aba wat künnte mer noch helfe?«
Apothekerin: »Wie wär’s mit Brausetabletten voller Elektrolyte, die bringen Sie wieder in Schwung. Un wenn der Kopf weiterhin lärmt, dann könnten Sie ein mildes Schmerzmittel wie Paracetamol nehmen.«
Jeck: »Dat jeht runter wie Öl! Un wat für’n Zuckerleckerli för den Magen? Heißt doch, wat Süßes kann och net schade.«
Apothekerin: »Vielleicht ne Banane, die gibt en schnellen Energieschub und tut auch dem Bauch gut. Un lassen Sie es ruhig angehen heute, ein letzter Karnevalstag ist schließlich auch ein Ruhetag!«
Jeck: »Joot, dat klingt wie Musik in meinen Ohren. Dann danke ich Ihnen, ich bin gleich wieder fit für den Endspurt gestern! Helau und vielen Dank!«
Apothekerin: »Helau! Und passen Sie gut auf sich auf, nächstes Jahr trinken wir alle ein Gläschen weniger, dat wäre vielleicht besser! Prost!«