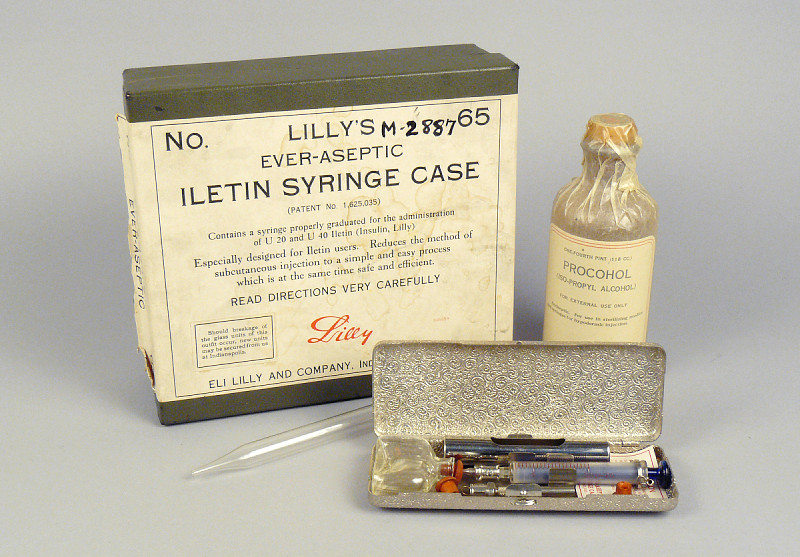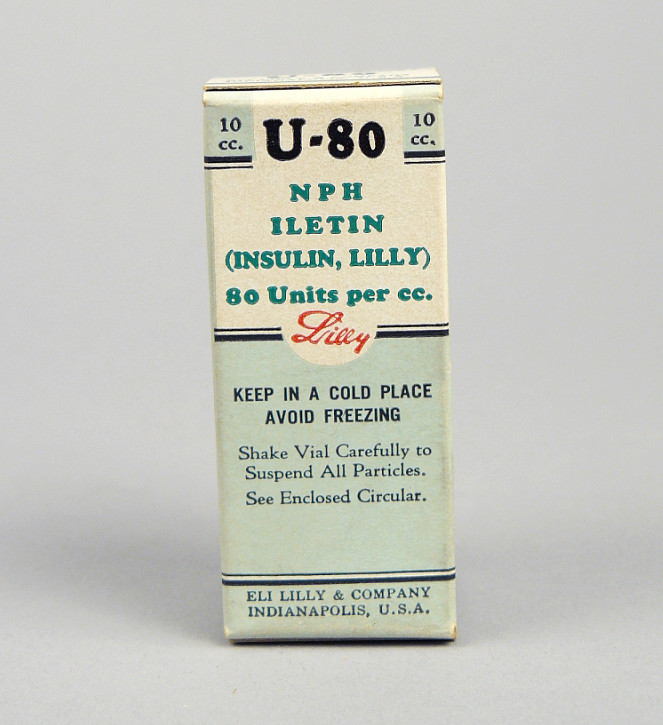(1) Vgl. insbes. Bliss, M., The discovery of insulin. 2. Aufl. Toronto 1996 und ders.: The discovery of insulin – the inside story. In: Higby, G.J., Stroud, E.C., The inside story of medicines, a symposium, Madison 1997, 93–99.
(2) Helmstädter, A., Vorbeugen ist besser als heilen. Zur Geschichte der aktiven Immunisierung. Pharm. uns. Zeit 37 (2008), 12-18.
(3) Helmstädter, A., Zufall und Strategie – zur Entwicklungsgeschichte der Antibiotika. Pharmakon 8 (2020), 217–224.
(4) Cieluch, A., et al., From islets of Langerhans to insulin analogs. It’s almost 100 years since the discovery of insulin. Clin. Diabetol. 8 (2019), 258–261.
(5) De Leiva-Hildalgo, A., de Leiva-Pérez, A., Pancreatic extracts for the treatment of diabetes (1889–1914): Acomatol. Am. J. Ther. 27 (2020), e1–e12. Die Einschätzung lautete: »Zuelzer can justly be regarded as the first person to have achieved even partial success in finding a pancreatic extract with potential therapeutic value.«
(6) de.wikipedia.org/wiki/Nicolae_Paulescu (Aufruf am 21.4.2021). Zu Prioritätsfragen vgl. ausf. Schadewaldt, H., Geschichte der Diabetes mellitus. Berlin u. a. 1975, 93–96.
(7) Zum genauen Verfahren vgl. Ried, W., Zur Insulingeschichte in Deutschland. Naturwissenschaftlich-pharmazeutische sowie sozial-medizinische und diätetische Aspekte seit der Isolierung des Insulins im Jahre 1921 bis zur Währungsreform 1948. Diss. Frankfurt 1986, 29–31.
(8) Tibaldi, J.M., Evolution of insulin development: Focus on key parameters. Adv. Ther. 29 (2012), 590–619.
(9) Lapolla, A., Dalfrà, A.G., Hundred years of insulin therapy: early purified insulins. Am. J. Ther. 27 (2020), e24–e29.
(10) Dilg, P., Insulinpräparate in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts. Zur Frühgeschichte der industriellen Insulin-Produktion in Deutschland. Pharm. uns. Zeit 30 (2001), 10-15.
(11) Hüntelmann, A.C., Making Salvarsan. Experimental therapy and the development and marketing of Salvarsan at the crossroads of science, clinical medicine, industry, and public health, in: Gaudillière, J.-P. et al., Ways of Regulating Drugs in the 19th and 20th Centuries. Basingstoke: Palgrave Macmillan, 2013, 43–65.
(12) Zu einzelnen Ansätzen vgl. ausf. Ried [wie Anm. 7], 74–154.
(13) Owens, D.R., Insulin preparations with prolonged effect. Diabetes Technol. Ther. 13, Suppl. 1 (2011), 5–14.
(14) Hagedorn, H.C., et al., Protamin insulinate. J. Am. Med. Assoc. 106 (1936), 177–180.
(15) Ried [wie Anm. 7], 115–117.
(16) Scott, A., Fisher, A.M., Studies on insulin with protamin. J. Pharmacol. Exper. Ther. 58 (1936), 78–92.
(17) Zit. n. Ried [wie Anm. 7], 120.
(18) Vgl. hierzu ausf. Ried [wie Anm. 7], 136-151.
(19) Sneader, W., Drug Discovery. A History. Hoboken 2005, S. 167.
(20) Vgl. hierzu Ried [wie Anm. 7], S. 140–143, sowie Meichsner, B., Wirth, U., Der Schlüssel zur Diabetes-Therapie. Insulin – Protein mit langer Geschichte. Chem. uns. Zeit 43 (2009), 340–346.
(21) Vgl. Pues, M., Insulin. Hormon aus Bakterien, Hefen und Pflanzen. Pharm. Ztg. 155 (2010), 3352–3353.
(22) Nuhn, P., Insulin. Pionier der Primärstruktur. Pharm. Ztg. 150 (2005), 1996–1997.
(23) Schadewaldt [wie Anm. 6], 114-116.
(24) Meichsner/Wirth [wie Anm. 20].
(25) Quianzon, C.C., Cheik, I., Insulin history. J. Comm. Hosp. Int. Med. Persp. 2 (2012), 18701.
(26) Gensthaler, B.M., Insulin Icodec. Nur einmal pro Woche spritzen. Pharm. Ztg. 166 (2021), 634.
(27) Ried [wie Anm. 7], 236–275.
(28) Gedawy, A. et al., Oral insulin delivery: existing barriers and current counterstrategies. J. Pharm. Pharmacol. 70 (2017), 197–213.
(29) Rex, J. et al., A review of 20 year’s experience with the Novopen® family of insulin injection devices. Clin. Drug Invest. 26 (2006), 367–401.
(30) Vgl. Alt. S., Quantensprung oder Me-too – Arzneimittelinnovationen im 20. Jahrhundert. Diss. phil. nat. Frankurt 2018, sowie Alt, S., Helmstädter, A., Market entry, power, pharmacokinetics: what makes a successful drug innovation? Drug Discov. Today 23 (2018), 208-212.